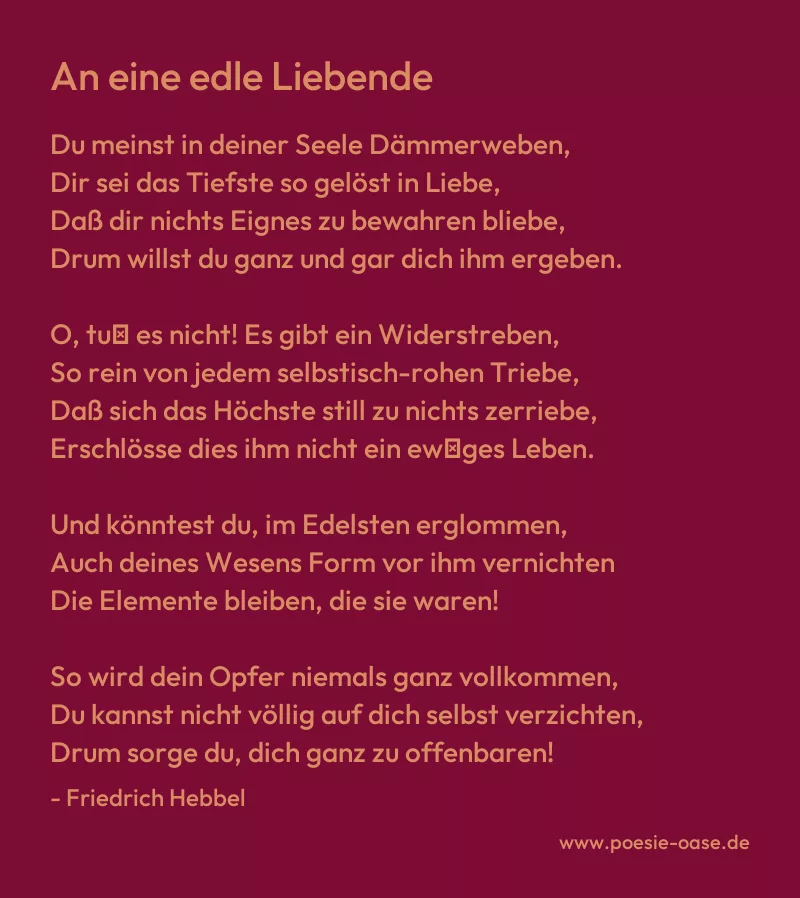An eine edle Liebende
Du meinst in deiner Seele Dämmerweben,
Dir sei das Tiefste so gelöst in Liebe,
Daß dir nichts Eignes zu bewahren bliebe,
Drum willst du ganz und gar dich ihm ergeben.
O, tu′ es nicht! Es gibt ein Widerstreben,
So rein von jedem selbstisch-rohen Triebe,
Daß sich das Höchste still zu nichts zerriebe,
Erschlösse dies ihm nicht ein ew′ges Leben.
Und könntest du, im Edelsten erglommen,
Auch deines Wesens Form vor ihm vernichten
Die Elemente bleiben, die sie waren!
So wird dein Opfer niemals ganz vollkommen,
Du kannst nicht völlig auf dich selbst verzichten,
Drum sorge du, dich ganz zu offenbaren!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
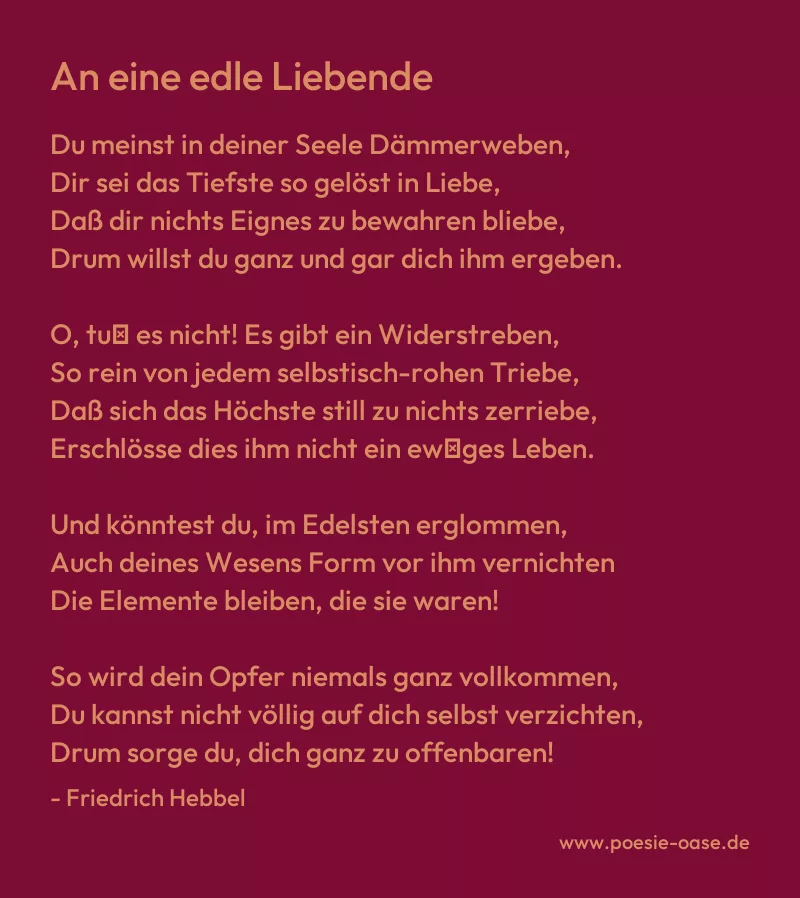
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine edle Liebende“ von Friedrich Hebbel ist eine Warnung und Ermutigung zugleich, die sich an eine Frau richtet, die sich in tiefster Liebe einem Mann hingeben möchte. Es thematisiert die Komplexität wahrer Hingabe und die Gefahr des vollständigen Selbstverlusts. Die Sprache ist pathetisch und von einer gewissen Schwere geprägt, die den Ernst der Thematik unterstreicht.
Im ersten Teil des Gedichts, in den ersten vier Versen, wird die Sehnsucht der Liebenden nach vollständiger Hingabe und Verschmelzung mit dem Geliebten ausgedrückt. Die Zeilen suggerieren, dass die Frau glaubt, in der Liebe ihr innerstes Wesen vollkommen auflösen zu können. Hebbel warnt jedoch vor diesem Wunsch. Er deutet an, dass es eine Form von Widerstreben gibt, eine innere Kraft, die es zu bewahren gilt, selbst in der tiefsten Liebe. Diese Kraft wird als „so rein von jedem selbstisch-rohen Triebe“ beschrieben, was die Reinheit und Unschuld dieser inneren Instanz betont.
Der zweite Teil des Gedichts, die Verse 5-8, führt die Warnung weiter aus. Hier wird die potenzielle Tragödie des vollständigen Aufgehens in der Liebe angedeutet. Der Dichter malt das Bild einer vollkommenen Selbstaufopferung, die jedoch letztendlich scheitern muss, da die Elemente, aus denen die Person besteht, immer erhalten bleiben. Das „Erschließen“ des Geliebten wird als Bedingung für ewiges Leben gesehen, was die Bedeutung der bewussten Offenbarung des eigenen Selbst hervorhebt.
Die letzten Verse, 9-12, verstärken diese Botschaft. Hebbel argumentiert, dass die vollständige Selbstaufgabe nicht möglich ist. Die Frau kann sich zwar in der Liebe entfachen und ihre äußere Form opfern, doch ihre inneren „Elemente“ bleiben bestehen. Dies führt zu dem Schluss, dass das Opfer niemals vollkommen sein kann und die wahre Liebe in der selbstbewussten Offenbarung des eigenen Wesens liegt, nicht im vollständigen Verlust der eigenen Identität. Die abschließenden Verse sind somit eine Aufforderung, sich in der Liebe zu öffnen, aber dabei die eigene Individualität zu bewahren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.