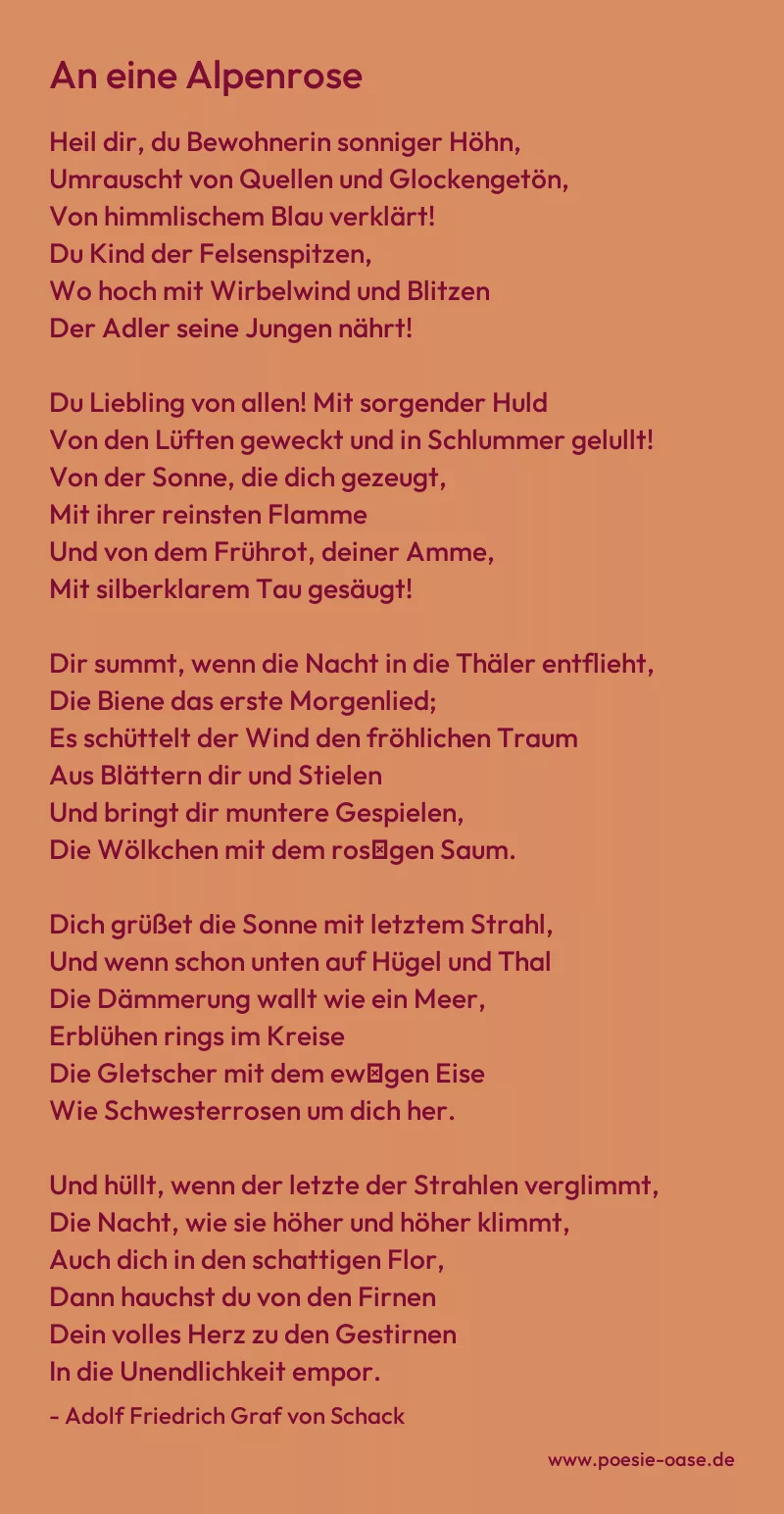An eine Alpenrose
Heil dir, du Bewohnerin sonniger Höhn,
Umrauscht von Quellen und Glockengetön,
Von himmlischem Blau verklärt!
Du Kind der Felsenspitzen,
Wo hoch mit Wirbelwind und Blitzen
Der Adler seine Jungen nährt!
Du Liebling von allen! Mit sorgender Huld
Von den Lüften geweckt und in Schlummer gelullt!
Von der Sonne, die dich gezeugt,
Mit ihrer reinsten Flamme
Und von dem Frührot, deiner Amme,
Mit silberklarem Tau gesäugt!
Dir summt, wenn die Nacht in die Thäler entflieht,
Die Biene das erste Morgenlied;
Es schüttelt der Wind den fröhlichen Traum
Aus Blättern dir und Stielen
Und bringt dir muntere Gespielen,
Die Wölkchen mit dem ros′gen Saum.
Dich grüßet die Sonne mit letztem Strahl,
Und wenn schon unten auf Hügel und Thal
Die Dämmerung wallt wie ein Meer,
Erblühen rings im Kreise
Die Gletscher mit dem ew′gen Eise
Wie Schwesterrosen um dich her.
Und hüllt, wenn der letzte der Strahlen verglimmt,
Die Nacht, wie sie höher und höher klimmt,
Auch dich in den schattigen Flor,
Dann hauchst du von den Firnen
Dein volles Herz zu den Gestirnen
In die Unendlichkeit empor.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
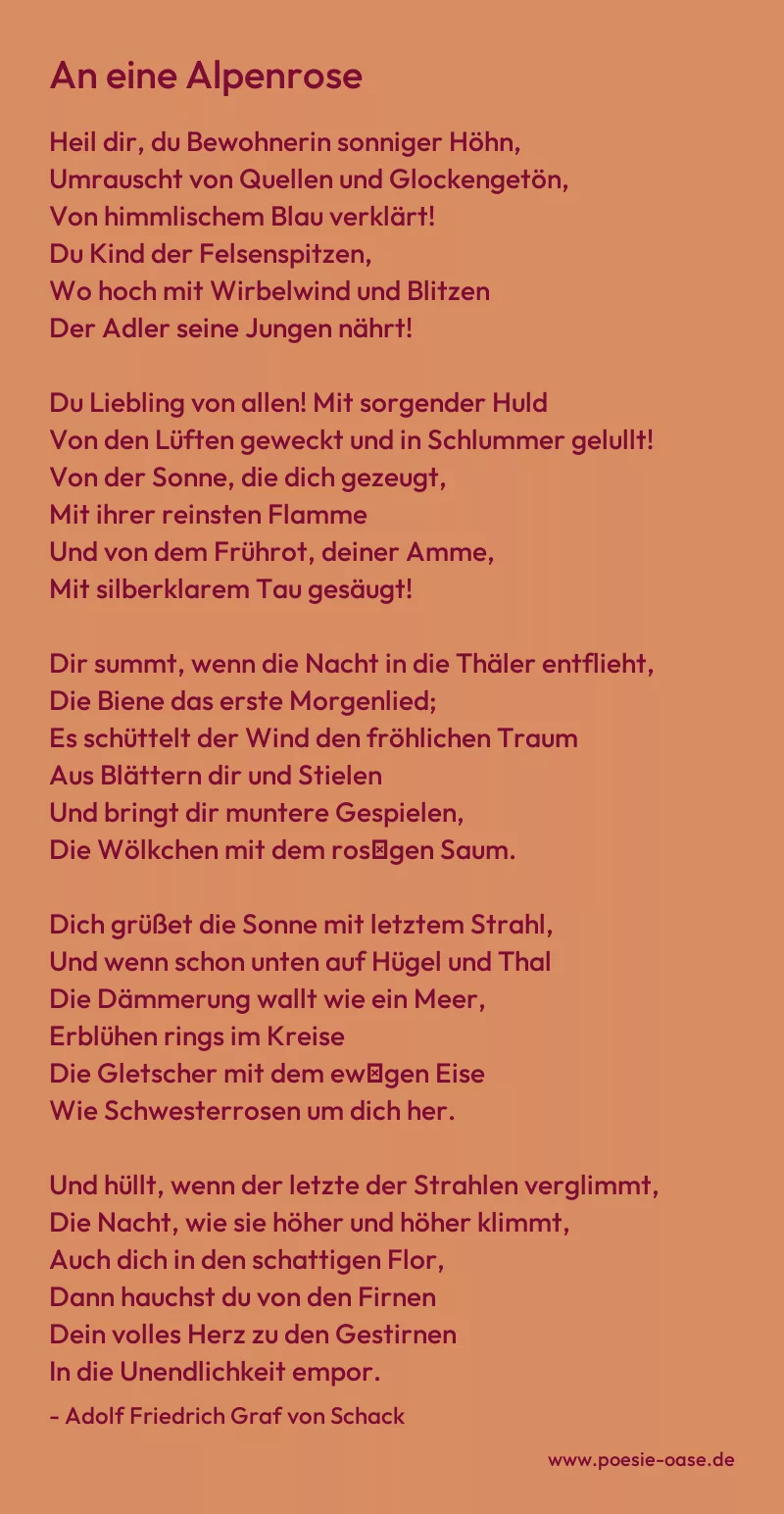
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine Alpenrose“ von Adolf Friedrich Graf von Schack ist eine poetische Hommage an die Schönheit und den einzigartigen Lebensraum einer Alpenrose. Es zeichnet ein idyllisches Bild der Alpenlandschaft, in der die Blume als zentrales Motiv fungiert. Der Dichter beschreibt die Alpenrose als Bewohnerin sonniger Höhen, umgeben von natürlichen Elementen wie Quellen, Glockenklängen und dem Himmelblau, wodurch eine Atmosphäre von Reinheit und Erhabenheit geschaffen wird. Die Verwendung von Wörtern wie „himmlisch“, „verklärt“ und „Liebling“ unterstreicht die Wertschätzung und Bewunderung, die der Dichter der Blume entgegenbringt.
Die zweite Strophe vertieft die Beschreibung, indem sie die Entstehung der Alpenrose im Detail darstellt. Sie wird als Kind der Felsenspitzen beschrieben, genährt von den Elementen: von den Lüften geweckt und in den Schlaf gelullt, von der Sonne „gezeugt“ und vom Tau „gesäugt“. Diese personifizierenden Bilder verleihen der Blume eine fast menschliche Qualität und betonen ihre enge Verbundenheit mit der Natur. Die poetische Sprache mit Begriffen wie „reinste Flamme“ und „silberklarer Tau“ erzeugt eine sinnliche Erfahrung und lässt den Leser die Schönheit und Reinheit der Alpenrose und ihrer Umgebung förmlich spüren.
Die dritte und vierte Strophe widmen sich dem täglichen Zyklus der Alpenrose, von den Morgenliedern der Biene bis zum letzten Strahl der Sonne. Die Blume wird in eine lebendige Gemeinschaft eingebettet, in der sie von verschiedenen Elementen der Natur gegrüßt und umgeben wird. Die Verwendung von Verben wie „summt“, „schüttelt“ und „grüßt“ verleiht der Szene eine Lebendigkeit und Dynamik. Besonders bemerkenswert ist die Gegenüberstellung von Licht und Schatten, wenn die Dämmerung in den Tälern aufzieht und die Gletscher mit ihrem ewigen Eis die Alpenrose umgeben, wodurch ein Gefühl von Harmonie und Kontrast entsteht.
In der abschließenden Strophe erreicht die Ehrung der Alpenrose ihren Höhepunkt, wenn die Nacht kommt. Auch wenn die Strahlen verglimmen und die Nacht ihren schattigen Flor ausbreitet, haucht die Alpenrose ihr „volles Herz“ zu den Gestirnen. Dieser Moment der Hingabe und des Ausdrucks des Gefühls symbolisiert die Verbindung der Blume mit der Unendlichkeit. Das Gedicht endet mit einer erhebenden Note, in der die Alpenrose als lebendiges Wesen dargestellt wird, das Teil des ewigen Kreislaufs der Natur ist. Es feiert somit die Schönheit, die Widerstandsfähigkeit und die spirituelle Bedeutung der Alpenrose in der alpinen Umgebung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.