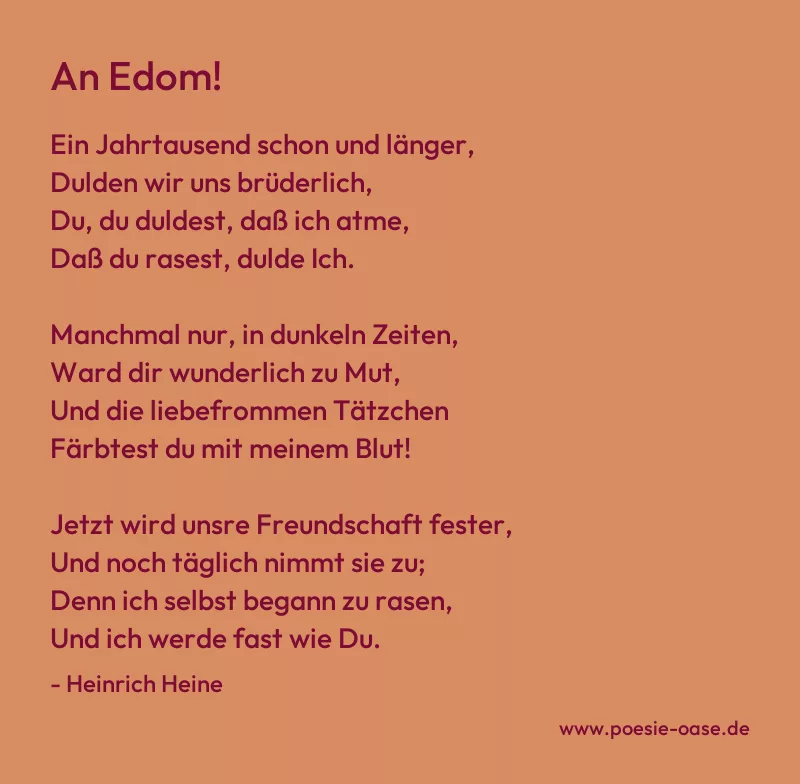An Edom!
Ein Jahrtausend schon und länger,
Dulden wir uns brüderlich,
Du, du duldest, daß ich atme,
Daß du rasest, dulde Ich.
Manchmal nur, in dunkeln Zeiten,
Ward dir wunderlich zu Mut,
Und die liebefrommen Tätzchen
Färbtest du mit meinem Blut!
Jetzt wird unsre Freundschaft fester,
Und noch täglich nimmt sie zu;
Denn ich selbst begann zu rasen,
Und ich werde fast wie Du.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
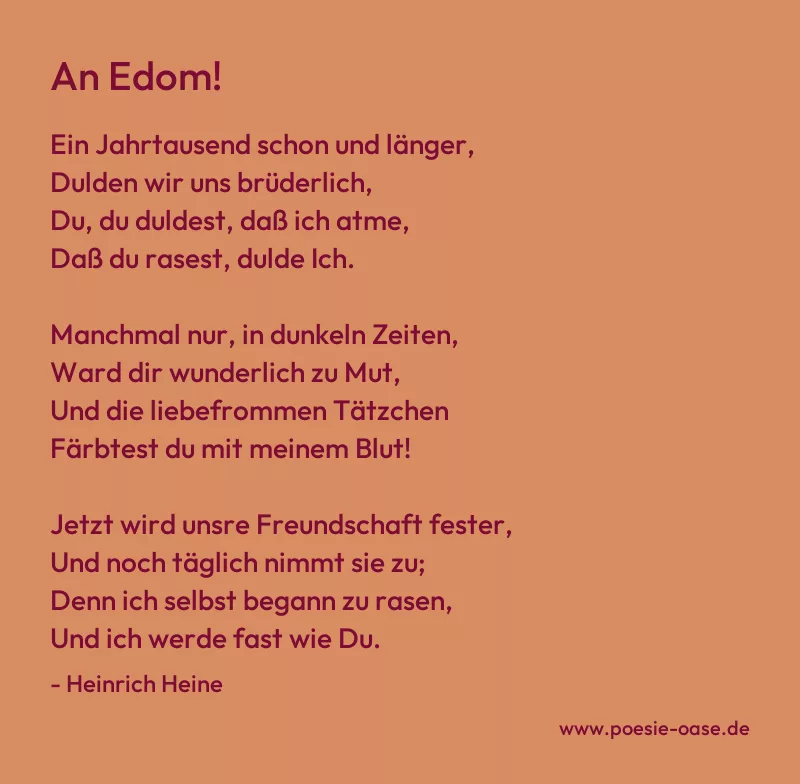
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Edom!“ von Heinrich Heine ist eine bittere Abrechnung mit den Judenverfolgungen und dem Antisemitismus. Es offenbart ein tiefes Gefühl von Ohnmacht und Erschöpfung, das sich in der über Jahrhunderte andauernden Erfahrung von Leid und Ungerechtigkeit manifestiert. Der Titel selbst deutet auf eine Konfrontation hin, da „Edom“ in der jüdischen Tradition oft als Metapher für Rom oder christliche Feinde verwendet wird. Heine wählt somit eine biblische Anspielung, um die historische Dimension des Konflikts zu unterstreichen.
In den ersten beiden Versen wird die ungleiche Beziehung zwischen dem Ich und dem „Du“ beschrieben. Das „Du“ (Edom) duldet scheinbar das Atmen des „Ich“ (den Juden), während das „Ich“ das Rasen des „Du“ ertragen muss. Diese Formulierung spiegelt ein Machtungleichgewicht wider, in dem das „Du“ die dominierende Rolle einnimmt und das „Ich“ in einer Position der Unterwerfung und des Leidens verharrt. Die Ironie liegt darin, dass das „Ich“ das Rasen des anderen duldet, während das „Du“ lediglich das Atmen des „Ich“ duldet, was die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit des Verhältnisses hervorhebt. Der zweite Abschnitt des Gedichts beschreibt die Gewalt in dunklen Zeiten, bei denen das Blut des „Ich“ vergossen wurde. Heine greift hier die Geschichte von Judenverfolgungen auf.
Die Wendung im letzten Teil des Gedichts ist besonders bemerkenswert. Heine stellt fest, dass die „Freundschaft“ (d.h. die Koexistenz) fester wird und täglich zunimmt, da er selbst beginnt zu rasen. Diese Entwicklung deutet auf eine zunehmende Verbitterung und den Verlust der Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz hin. Die Zeile „Und ich werde fast wie Du“ ist der Höhepunkt dieser Verzweiflung und deutet auf die Gefahr einer Angleichung an die Haltung des Unterdrückers hin. Heine scheint hier die Erschöpfung des anhaltenden Leidens zu zeigen und die Gefahr, dass der Unterdrückte die Eigenschaften des Unterdrückers übernimmt.
Die Sprache des Gedichts ist prägnant und voller Emotionen. Heine verwendet einfache Worte und eine klare Struktur, um seine Botschaft eindrücklich zu vermitteln. Die Wahl des Reimschemas (Kreuzreim) verstärkt den melodischen Charakter und unterstreicht die rhythmische Intensität der Zeilen. Der Kontrast zwischen der scheinbaren Brüderlichkeit im ersten Vers und der Brutalität in den folgenden Zeilen verdeutlicht die innere Zerrissenheit und das Gefühl der Ohnmacht, das in dem Gedicht zum Ausdruck kommt. Das Gedicht dient somit als eine erschütternde Reflexion über die anhaltende Erfahrung von Antisemitismus und die psychologischen Auswirkungen auf die Opfer.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.