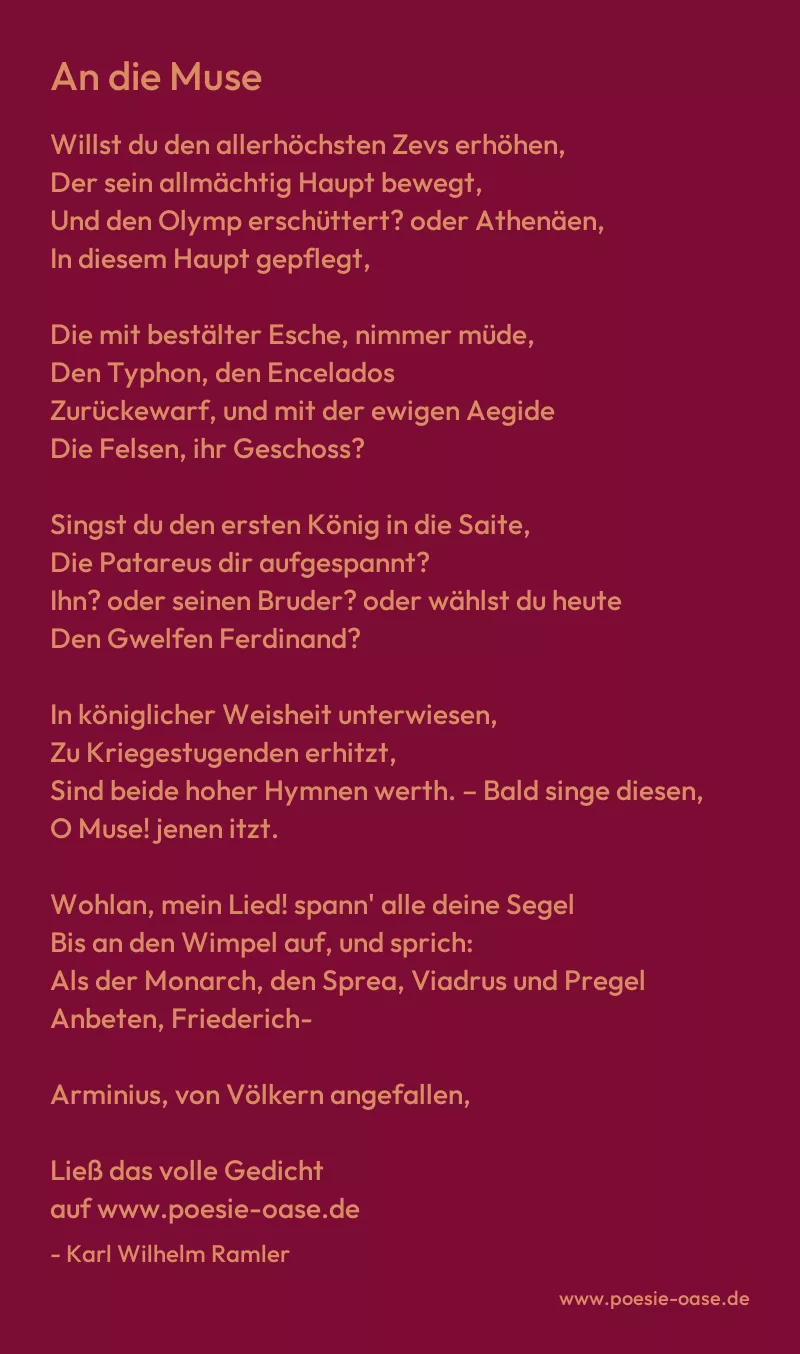Willst du den allerhöchsten Zevs erhöhen,
Der sein allmächtig Haupt bewegt,
Und den Olymp erschüttert? oder Athenäen,
In diesem Haupt gepflegt,
Die mit bestälter Esche, nimmer müde,
Den Typhon, den Encelados
Zurückewarf, und mit der ewigen Aegide
Die Felsen, ihr Geschoss?
Singst du den ersten König in die Saite,
Die Patareus dir aufgespannt?
Ihn? oder seinen Bruder? oder wählst du heute
Den Gwelfen Ferdinand?
In königlicher Weisheit unterwiesen,
Zu Kriegestugenden erhitzt,
Sind beide hoher Hymnen werth. – Bald singe diesen,
O Muse! jenen itzt.
Wohlan, mein Lied! spann‘ alle deine Segel
Bis an den Wimpel auf, und sprich:
Als der Monarch, den Sprea, Viadrus und Pregel
Anbeten, Friederich-
Arminius, von Völkern angefallen,
Die Neid und Wahn und Hass verband,
Mit seinem Donner nicht allgegenwärtig allen
Und ewig widerstand:
Da brach, genährt im sorgelosen Frieden,
Gleich einem neuen Meteor,
Das den Orion auslöscht und die Tyndariden,
Prinz Heinrichs Geist hervor.
Als Jüngling schlief er ehmals in der Höhle
Anoniens, und war die Lust
Der Musen; itzt erhöheten sie seine Seele:
Mit unbewegter Brust
Hielt er der Söhne Teuts verschworne Heere
Züruck von unsrer Flur; (so stand
Das Isthmische Gebirge, trennte beide Meere,
Ward zweyer Völker Band;)
Und plötzlich schlug er die betäubten Schaaren,
Und krönete, diess war der Schluss
Der Götter! jene zwölf Herkulischen Gefahren
Des Deutschen Genius.
Wagst du noch mehr zu singen? – Dass der Sieger,
So weit er in der Feinde Land
Mit seinem Lager flog, gesegnet, seine Krieger
Zum Wohlthun ausgefandt?
Selbst unerforschlich, jeden Anschlag kannte?
Früh thätig, jeden hintertrieb? –
Nein; sage, dass ihn Friedrich selbst den Feldherrn nannte,
Der ohne Fehler blieb.