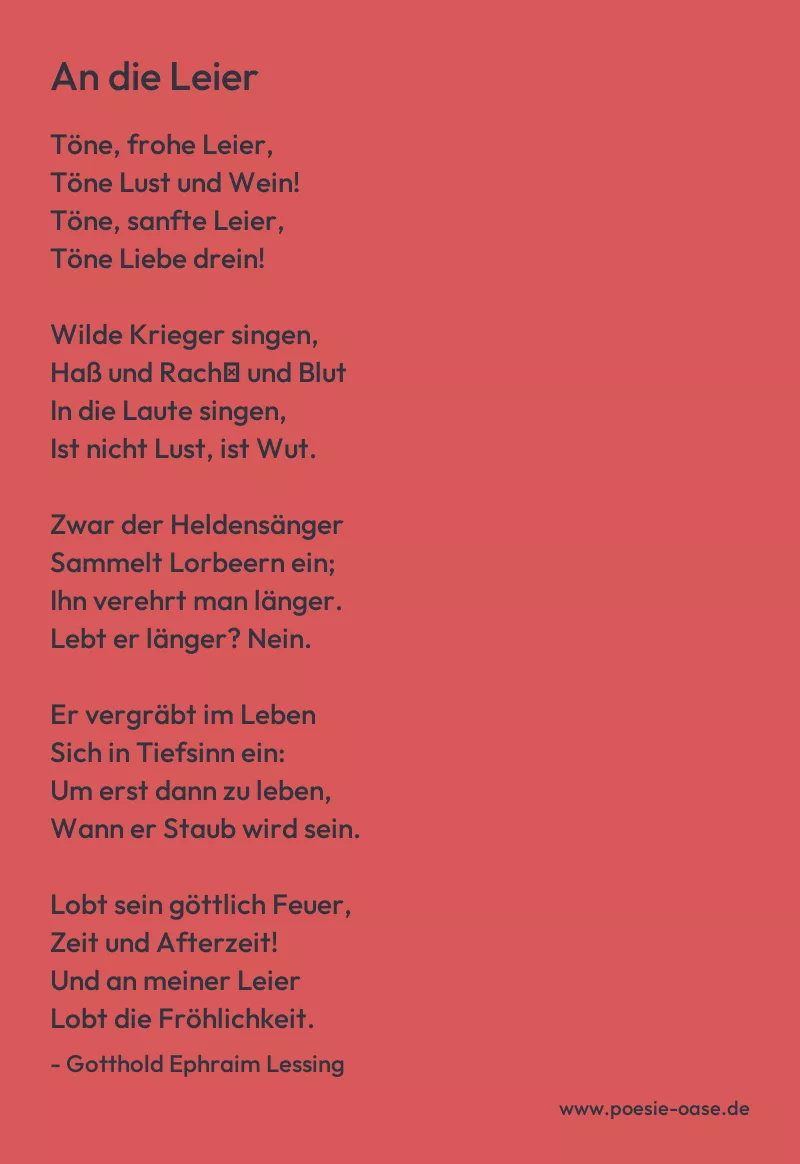An die Leier
Töne, frohe Leier,
Töne Lust und Wein!
Töne, sanfte Leier,
Töne Liebe drein!
Wilde Krieger singen,
Haß und Rach′ und Blut
In die Laute singen,
Ist nicht Lust, ist Wut.
Zwar der Heldensänger
Sammelt Lorbeern ein;
Ihn verehrt man länger.
Lebt er länger? Nein.
Er vergräbt im Leben
Sich in Tiefsinn ein:
Um erst dann zu leben,
Wann er Staub wird sein.
Lobt sein göttlich Feuer,
Zeit und Afterzeit!
Und an meiner Leier
Lobt die Fröhlichkeit.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
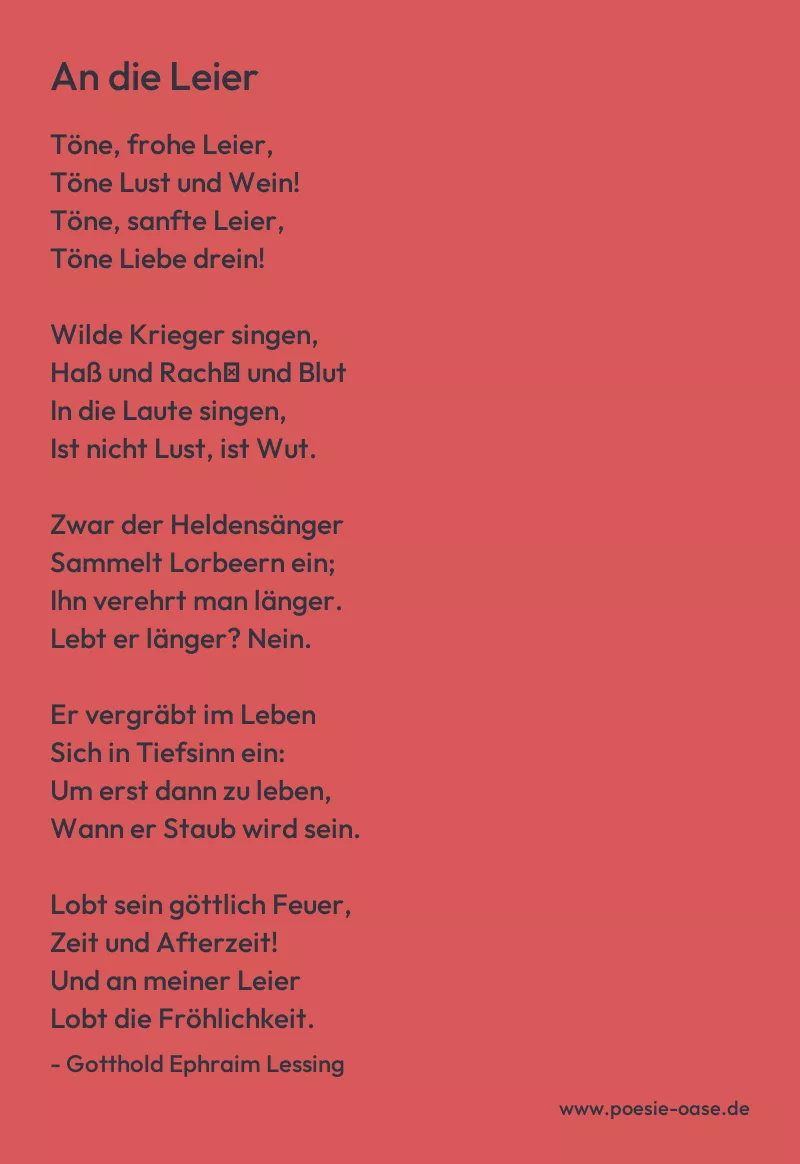
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die Leier“ von Gotthold Ephraim Lessing ist eine poetische Reflexion über die Themen Freude, Liebe und die Vergänglichkeit des Ruhms, die durch den Kontrast zwischen fröhlichen und kriegerischen Liedern dargestellt werden. Lessing spricht in diesem Gedicht direkt seine Lyra an, wobei die Wahl der Worte und die Betonung auf bestimmten Stimmungen die Botschaft des Dichters unterstreicht. Das Gedicht plädiert für die Wertschätzung von Fröhlichkeit und Liebe gegenüber kriegerischen Themen, welche Vergeltung und Hass thematisieren.
Die ersten vier Verse fordern die Leier auf, Töne der Lust, des Weins und der Liebe zu spielen. Der Autor etabliert damit ein Leitmotiv der Freude und des Genusses als zentrale Werte seines Gedichts. Die Wiederholung des Wortes „Töne“ zu Beginn jedes Verses verstärkt den Appell an die Leier und unterstreicht die Dringlichkeit und den Wunsch nach diesen fröhlichen Melodien. Der Kontrast zwischen den fröhlichen Themen und den nachfolgenden Kriegerliedern wird durch die Wahl der Wörter, die sanft und wohltuend wirken, deutlich.
Die folgenden Verse (5-8) wenden sich von der Freude ab und vergleichen die fröhlichen Lieder mit den kriegerischen Liedern. Lessing kritisiert die „Wut“, die durch Hass und Rachsucht in kriegerischen Liedern zum Ausdruck kommt. Der Autor betont die Unvereinbarkeit von Lust und Krieg und etabliert somit die Gegensätze, die das Gedicht strukturieren. Die Verwendung von Begriffen wie „Haß“, „Rach’“ und „Blut“ in Bezug auf die „Laute“ kontrastiert stark mit den sanften Tönen der Liebe und unterstreicht die Ablehnung des Autors von kriegerischen Themen.
Die letzten beiden Strophen reflektieren die Vergänglichkeit des Ruhms und des Heldentums. Lessing stellt fest, dass Heldensänger zwar „Lorbeern“ ernten und länger verehrt werden, aber ihr Leben nicht unbedingt verlängert wird. Er deutet an, dass diese Helden ihr Leben der Suche nach Ruhm widmen, indem sie sich in „Tiefsinn“ vergraben, nur um im Tod, „wann er Staub wird sein“, wahres Leben zu erfahren. Lessing beendet das Gedicht mit einem Loblied auf die „Fröhlichkeit“, indem er die göttliche Verehrung des Feuers, der Zeit und der „Afterzeit“ ablehnt und stattdessen die Freude als zentrale Wertvorstellung seines Gedichts hervorhebt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.