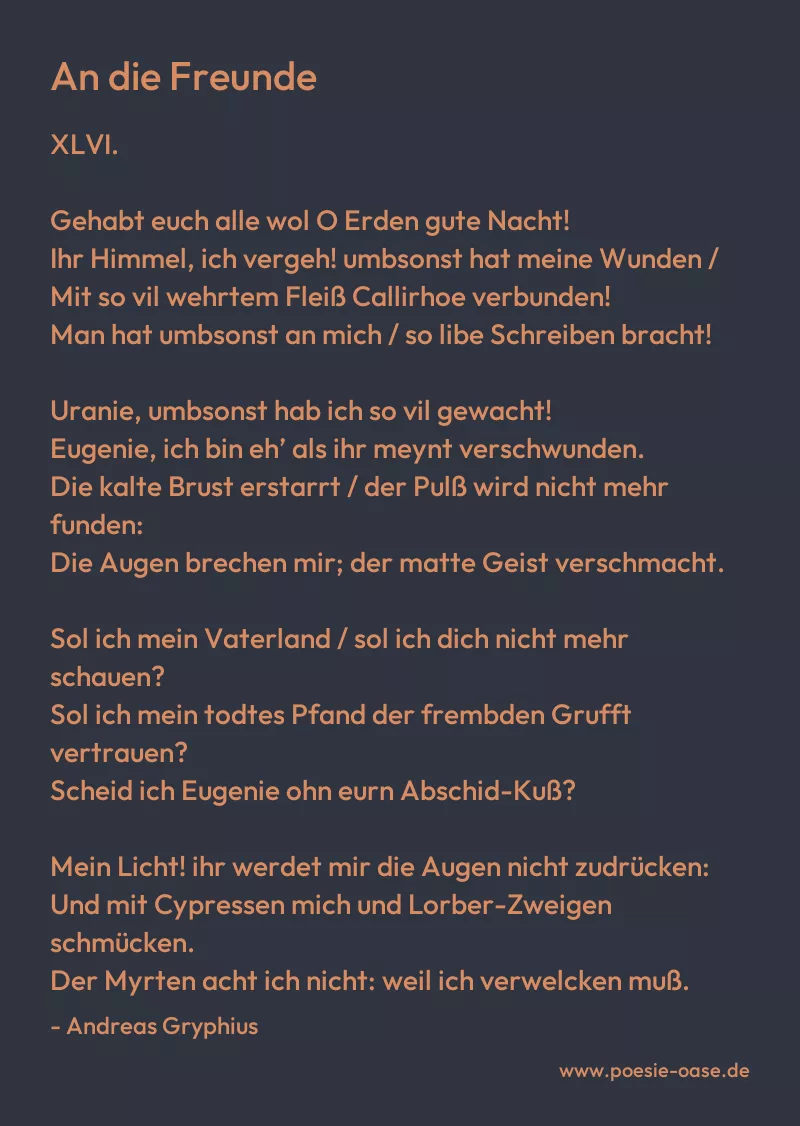An die Freunde
XLVI.
Gehabt euch alle wol O Erden gute Nacht!
Ihr Himmel, ich vergeh! umbsonst hat meine Wunden /
Mit so vil wehrtem Fleiß Callirhoe verbunden!
Man hat umbsonst an mich / so libe Schreiben bracht!
Uranie, umbsonst hab ich so vil gewacht!
Eugenie, ich bin eh’ als ihr meynt verschwunden.
Die kalte Brust erstarrt / der Pulß wird nicht mehr funden:
Die Augen brechen mir; der matte Geist verschmacht.
Sol ich mein Vaterland / sol ich dich nicht mehr schauen?
Sol ich mein todtes Pfand der frembden Grufft vertrauen?
Scheid ich Eugenie ohn eurn Abschid-Kuß?
Mein Licht! ihr werdet mir die Augen nicht zudrücken:
Und mit Cypressen mich und Lorber-Zweigen schmücken.
Der Myrten acht ich nicht: weil ich verwelcken muß.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
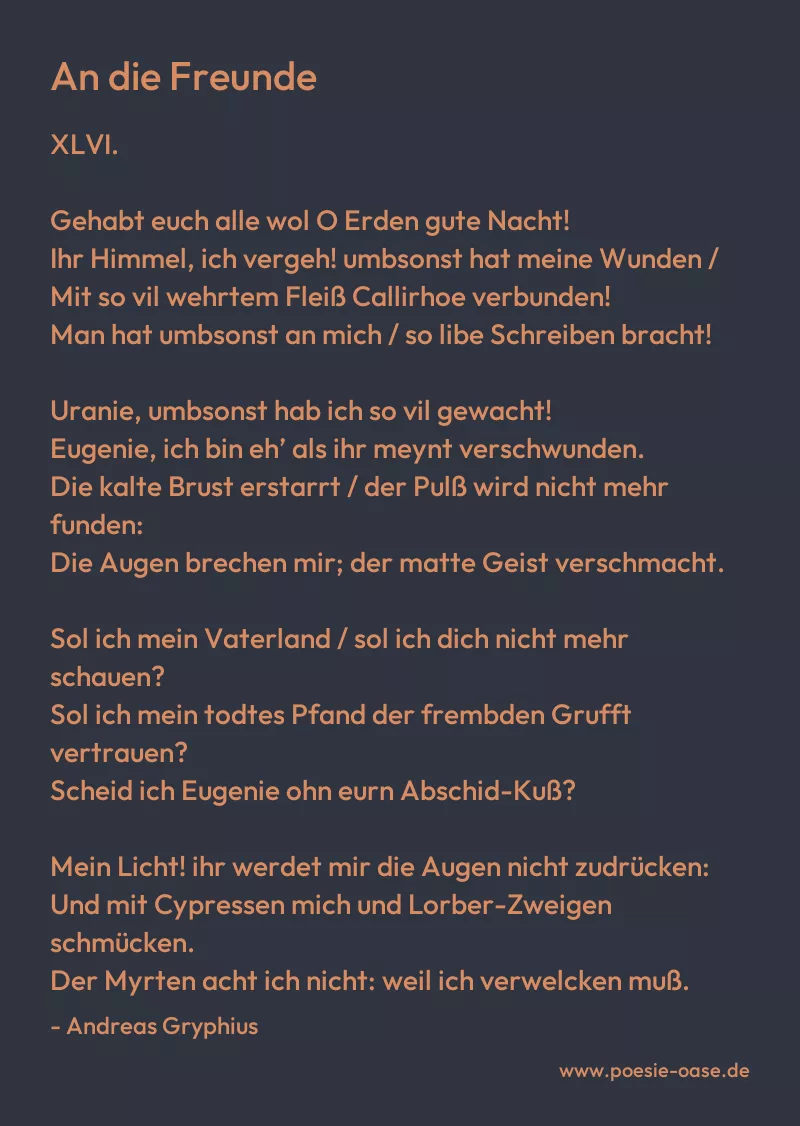
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An die Freunde“ von Andreas Gryphius ist ein bewegender Abschiedsbrief, der die Verzweiflung und den Schmerz des lyrischen Ichs angesichts des nahenden Todes thematisiert. Es ist ein Abschied von der Welt, von geliebten Menschen und vom Leben selbst. Der Dichter blickt zurück auf sein Leben, das durch Fleiß und die Liebe zu den Musen geprägt war, und drückt seine Enttäuschung über das bevorstehende Ende aus. Die Verwendung von Ausrufen und rhetorischen Fragen verstärkt die Intensität der Emotionen und vermittelt ein Gefühl von Hilflosigkeit und Verzweiflung.
In den ersten vier Versen wendet sich das lyrische Ich an die Welt und die Himmelsmächte, ein letzter Gruß an die Erde und der verzweifelte Appell an den Himmel. Die Anrufung der Musen Callirhoe und Uranie deutet auf das Streben nach Kunst und Wissen hin, das nun durch den Tod beendet wird. Die Betonung des „umsonst“ unterstreicht die Sinnlosigkeit des Sterbens, das alle Anstrengungen und Bemühungen des Dichters zunichtemacht. Die Erwähnung der „libe Schreiben“ verweist auf die Bedeutung der Kunst und des dichterischen Schaffens für das lyrische Ich.
Der zweite Teil des Gedichts (Verse 5-8) vertieft das Gefühl der Verlorenheit und des Abschieds. Die körperlichen Zeichen des Todes, wie das Erstarren der Brust, der Verlust des Pulses und das Verlöschen der Augen, werden eindrücklich geschildert. Die Nennung von Eugenie, einer geliebten Person, zeigt die tiefe Trauer über den Abschied von den Lebenden. Der Dichter scheint zu erkennen, dass er früher sterben muss, als er erwartet hatte. Hier zeigt sich die Angst vor dem Verlust der Lebenskraft und der Liebe.
In den letzten vier Versen wendet sich das lyrische Ich an sein Vaterland und seine geliebte Eugenie. Die rhetorischen Fragen drücken die Sehnsucht nach dem Leben und die Angst vor dem Tod aus. Die Bitte, nicht in einer fremden Gruft beerdigt zu werden, sondern die Sehnsucht nach der Heimat, unterstreicht die tiefe Verbundenheit des Dichters mit seiner Umgebung. Die abschließenden Verse enthalten eine letzte Bitte an die Freunde: Sie sollen ihm die Augen schließen und ihn mit Lorbeerzweigen schmücken, während er die Myrten, Symbole der Liebe, verschmäht. Dies deutet darauf hin, dass der Tod nicht nur ein Abschied vom Leben, sondern auch ein Übergang in eine neue Existenzform ist, die durch das Gedenken an die Freunde und die Wertschätzung der Kunst geprägt sein soll.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.