Dir, o Sohn der Juno! sey dieser Marmorheerd heilig,
Herrscher der Feueressen in Lemnos,
Der du mit flammender Lohe den aufgebläheten Xanthus
Halb verraucht in sein Lager zurück zwangst,
Daß du den Boreas hier und sein kaltes Gefolge verjagest.
Dankbar weih‘ ich dir täglich ein Opfer,
Ein unsträfliches Blatt, von der schönen Elvire geschrieben,
Der Vermählten des mürrischen Balbus.
Daß kein böser Verdacht die muntere Freundin entehre,
Lodre dir, eifersüchtigem Gatten
Der süß lächelnden Cypria, sonder Reue dies Opfer,
Wann ich am Morgen vor deinem Altare
Die geröstete Frucht des Arabischen Kaffeebaums trinke,
Und ein blaues Ambrosienwölkchen
Mir die Stirn umwirbelt, gleich einem der seligen Götter;
Oder am Abend den Fürsten der Deutschen
Weine versuche, den einst er reiche Patricier Ulfo
Feierlich schwur so lange zu schonen,
Bis ihm ein lachender Sohn entgegen lallte; der aber,
Dreißig Jahre sein Weibchen bewachend,
Ohne Sohn verstarb und ohne den sorgsam bewahrten
Festwein, dessen Erlösung anhebt.
An den Vulkan
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
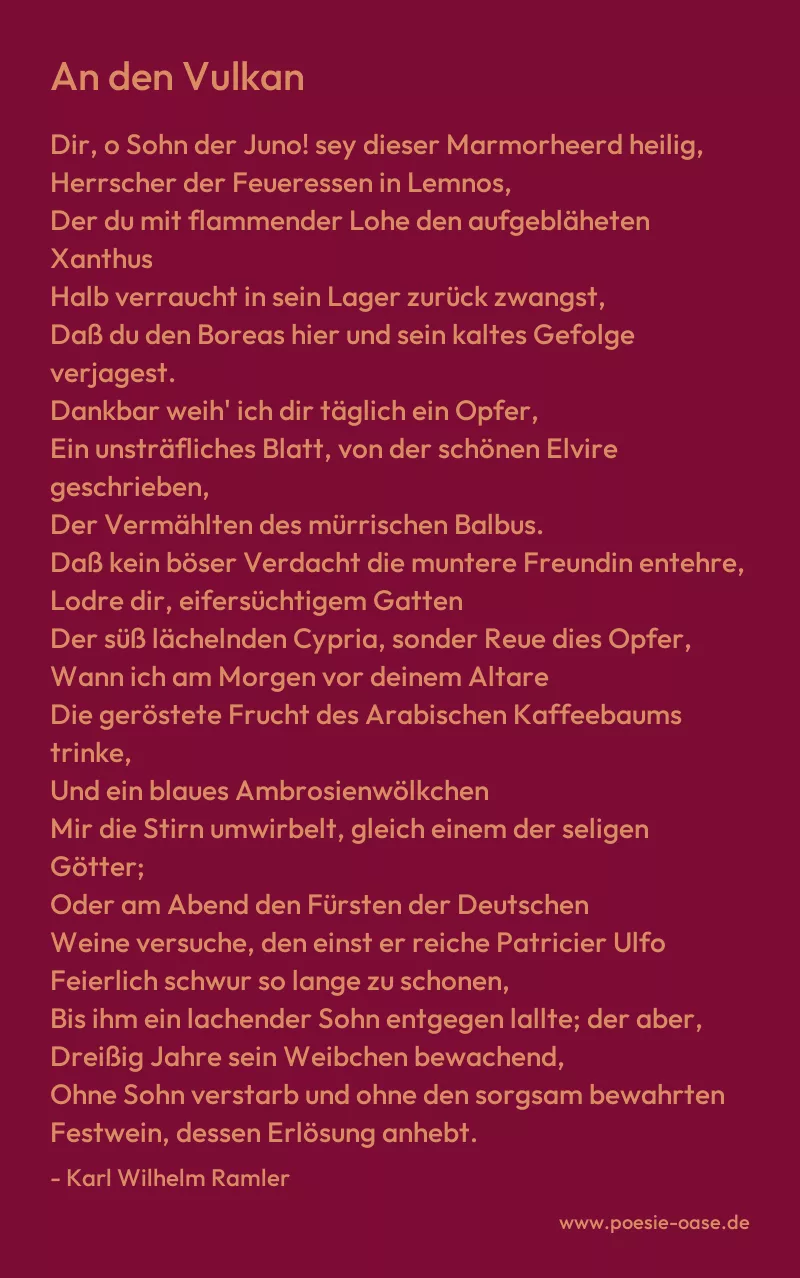
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Vulkan“ von Karl Wilhelm Ramler ist eine Ode an den Vulkan, in der dieser als Beschützer und Hüter dargestellt wird. Der Dichter widmet dem Vulkan einen marmornen Herd, eine Opfergabe, und preist dessen Fähigkeit, die Elemente zu beherrschen, wie die Rückdrängung des Flusses Xanthus mit Flammen. Die Anrufung des Vulkans offenbart eine Verehrung, die über eine bloße Naturbetrachtung hinausgeht und eine tiefe Ehrfurcht vor den Kräften der Natur zum Ausdruck bringt.
Der zweite Teil des Gedichts ist durch eine Widmung an Elvire, die Frau des mürrischen Balbus, geprägt. Ramler wünscht, dass kein böser Verdacht Elvire entehre, und opfert dem Vulkan, um die Freundschaft zu bewahren. Diese Passage deutet auf eine persönliche Beziehung und die Sorge um die Ehre und das Wohlergehen der Freundin hin. Die Erwähnung des „süß lächelnden Cypria“, also Aphrodite, fügt eine erotische Note hinzu und lässt auf eine Dreiecksbeziehung oder zumindest auf eine erotische Spannung schließen.
Die letzten Verse greifen die Thematik des Opfers und der Verehrung wieder auf, indem sie beschreiben, wie der Dichter am Morgen Kaffee trinkt und am Abend Wein probiert, wobei er den Vulkan als Zeugen und Beschützer anruft. Hier wird ein humorvoller Kontrast zur erhabenen Anrufung des Vulkans geschaffen. Die Anspielung auf den Fürsten der Deutschen und den Patriziers Ulfo, der seinen Wein sorgsam bewahrte, fügt eine ironische Note hinzu und deutet auf die Absurdität menschlicher Wünsche und Hoffnungen hin.
Insgesamt ist das Gedicht ein komplexes Gebilde aus Verehrung, Erotik und Ironie. Es verbindet die erhabene Natur des Vulkans mit den menschlichen Erfahrungen von Freundschaft, Liebe und dem Streben nach Genuss. Ramler nutzt eine gehobene Sprache und rhetorische Figuren, um eine vielschichtige Botschaft zu vermitteln, die von der Bewunderung der Natur bis zur Kritik an menschlichen Schwächen reicht. Die Opfergaben, die dem Vulkan dargebracht werden, symbolisieren sowohl die Verehrung der Naturkräfte als auch die Suche nach Schutz und Wohlstand in der menschlichen Welt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
