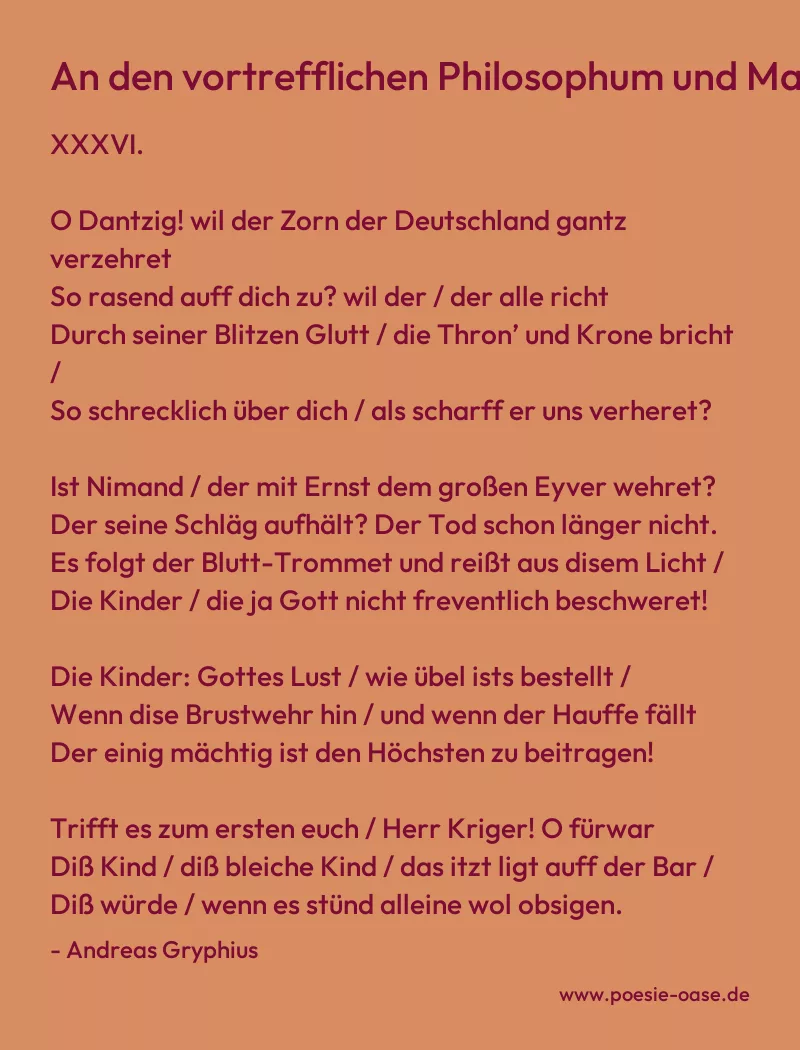An den vortrefflichen Philosophum und Mathematicum
XXXVI.
O Dantzig! wil der Zorn der Deutschland gantz verzehret
So rasend auff dich zu? wil der / der alle richt
Durch seiner Blitzen Glutt / die Thron’ und Krone bricht /
So schrecklich über dich / als scharff er uns verheret?
Ist Nimand / der mit Ernst dem großen Eyver wehret?
Der seine Schläg aufhält? Der Tod schon länger nicht.
Es folgt der Blutt-Trommet und reißt aus disem Licht /
Die Kinder / die ja Gott nicht freventlich beschweret!
Die Kinder: Gottes Lust / wie übel ists bestellt /
Wenn dise Brustwehr hin / und wenn der Hauffe fällt
Der einig mächtig ist den Höchsten zu beitragen!
Trifft es zum ersten euch / Herr Kriger! O fürwar
Diß Kind / diß bleiche Kind / das itzt ligt auff der Bar /
Diß würde / wenn es stünd alleine wol obsigen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
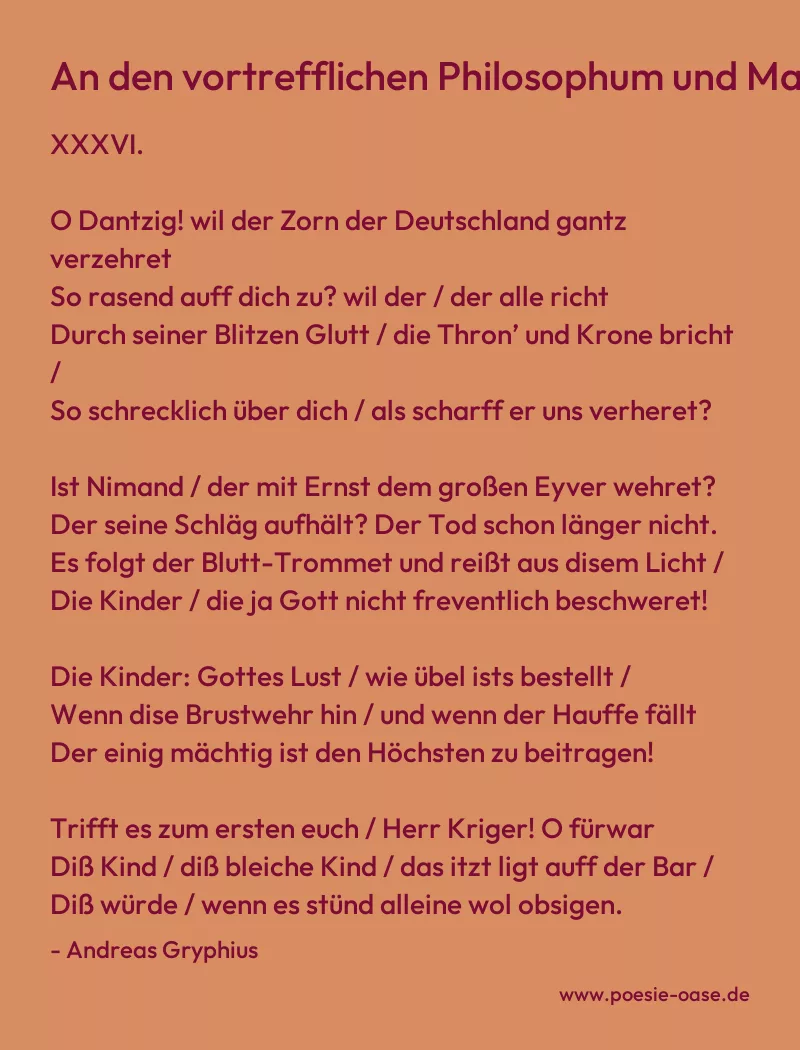
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den vortrefflichen Philosophum und Mathematicum“ von Andreas Gryphius ist eine Klage über die Zerstörung und das Leid, die durch Krieg und Gewalt verursacht werden. Gryphius wendet sich an eine Person von Intellekt und wissenschaftlicher Bedeutung (Philosophum und Mathematicum) und beklagt die Zerstörung der Stadt Danzig und die allgemeine Verwüstung in Deutschland während des Dreißigjährigen Krieges.
Die ersten Strophen beschreiben die Zerstörung, die durch den Krieg verursacht wird, indem der Autor die Stadt Danzig direkt anspricht. Er fragt, ob der Zorn, der Deutschland verzehrt, nun auch Danzig treffen wird. Die rhetorischen Fragen und die drastischen Bilder von Blitz und Feuer verdeutlichen die Zerstörung und das Grauen des Krieges. Die zentrale Frage ist, ob es jemanden gibt, der dem Zorn Einhalt gebieten kann, ein Thema, das die Hoffnungslosigkeit und das Leid der Zeit widerspiegelt.
In den folgenden Zeilen wechselt Gryphius zu einer direkteren, pathetischen Ansprache. Er beklagt den Verlust unschuldiger Menschen, insbesondere Kinder, die in diesem Wirbelwind der Gewalt leiden müssen. Diese Kinder werden als „Gottes Lust“ bezeichnet, was ihre Unschuld und Reinheit hervorhebt. Der Autor drückt seine Verzweiflung über den Verlust dieser Kinder aus, indem er die Tragödie des Krieges und seinen Einfluss auf die Unschuld betont.
Die letzte Strophe richtet sich direkt an eine Person namens „Herr Kriger“ und bezieht sich auf ein Kind, das bereits gestorben ist und nun auf der Bahre liegt. Gryphius beschreibt das Kind als „bleich“ und spekuliert, dass es, wäre es am Leben, „alleine wol obsigen“ könnte. Dies deutet eine Sehnsucht nach Hoffnung und Stärke an und spiegelt die Idee wider, dass selbst ein Kind, rein und unschuldig, durch seine bloße Existenz die Hoffnung verkörpern könnte, die angesichts der Verzweiflung und Zerstörung durch den Krieg so dringend benötigt wird. Die letzte Zeile, voll von Pathos, drückt die tiefe Verzweiflung und den Verlust aus, der durch den Krieg verursacht wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.