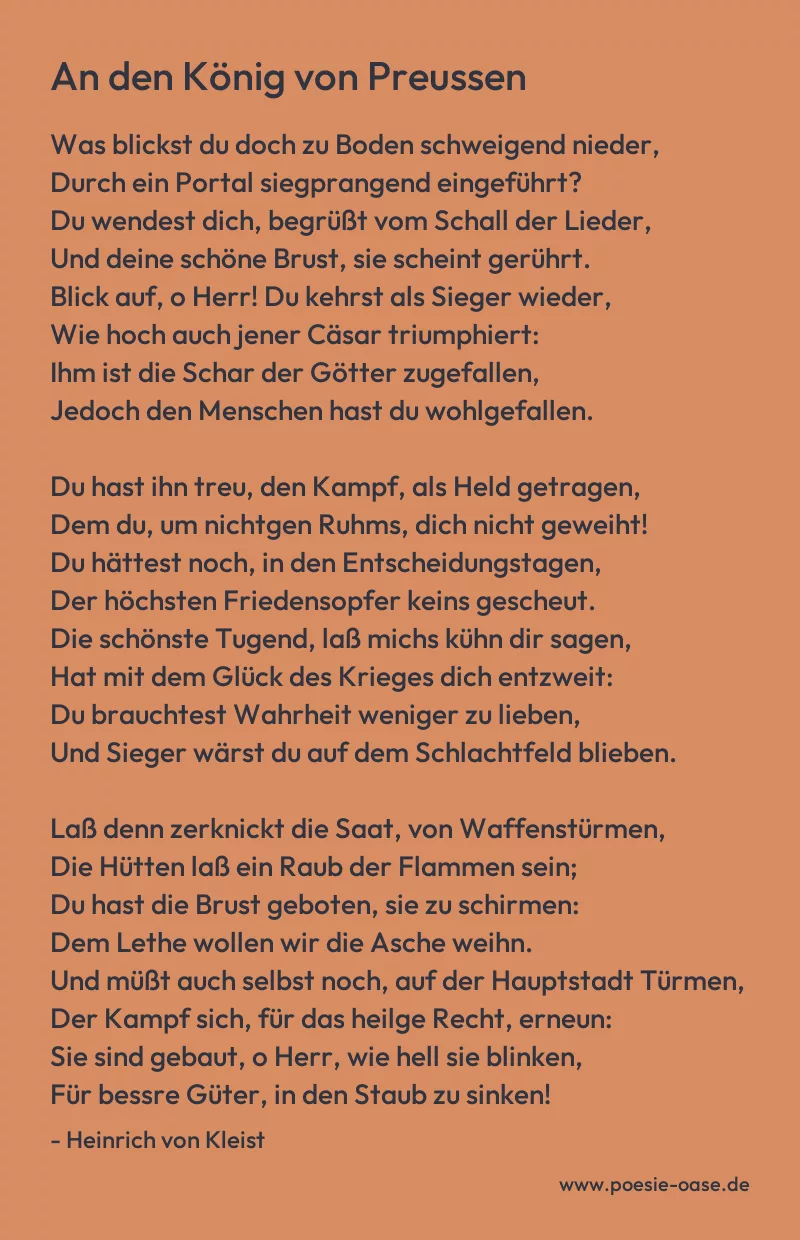An den König von Preussen
Was blickst du doch zu Boden schweigend nieder,
Durch ein Portal siegprangend eingeführt?
Du wendest dich, begrüßt vom Schall der Lieder,
Und deine schöne Brust, sie scheint gerührt.
Blick auf, o Herr! Du kehrst als Sieger wieder,
Wie hoch auch jener Cäsar triumphiert:
Ihm ist die Schar der Götter zugefallen,
Jedoch den Menschen hast du wohlgefallen.
Du hast ihn treu, den Kampf, als Held getragen,
Dem du, um nichtgen Ruhms, dich nicht geweiht!
Du hättest noch, in den Entscheidungstagen,
Der höchsten Friedensopfer keins gescheut.
Die schönste Tugend, laß michs kühn dir sagen,
Hat mit dem Glück des Krieges dich entzweit:
Du brauchtest Wahrheit weniger zu lieben,
Und Sieger wärst du auf dem Schlachtfeld blieben.
Laß denn zerknickt die Saat, von Waffenstürmen,
Die Hütten laß ein Raub der Flammen sein;
Du hast die Brust geboten, sie zu schirmen:
Dem Lethe wollen wir die Asche weihn.
Und müßt auch selbst noch, auf der Hauptstadt Türmen,
Der Kampf sich, für das heilge Recht, erneun:
Sie sind gebaut, o Herr, wie hell sie blinken,
Für bessre Güter, in den Staub zu sinken!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
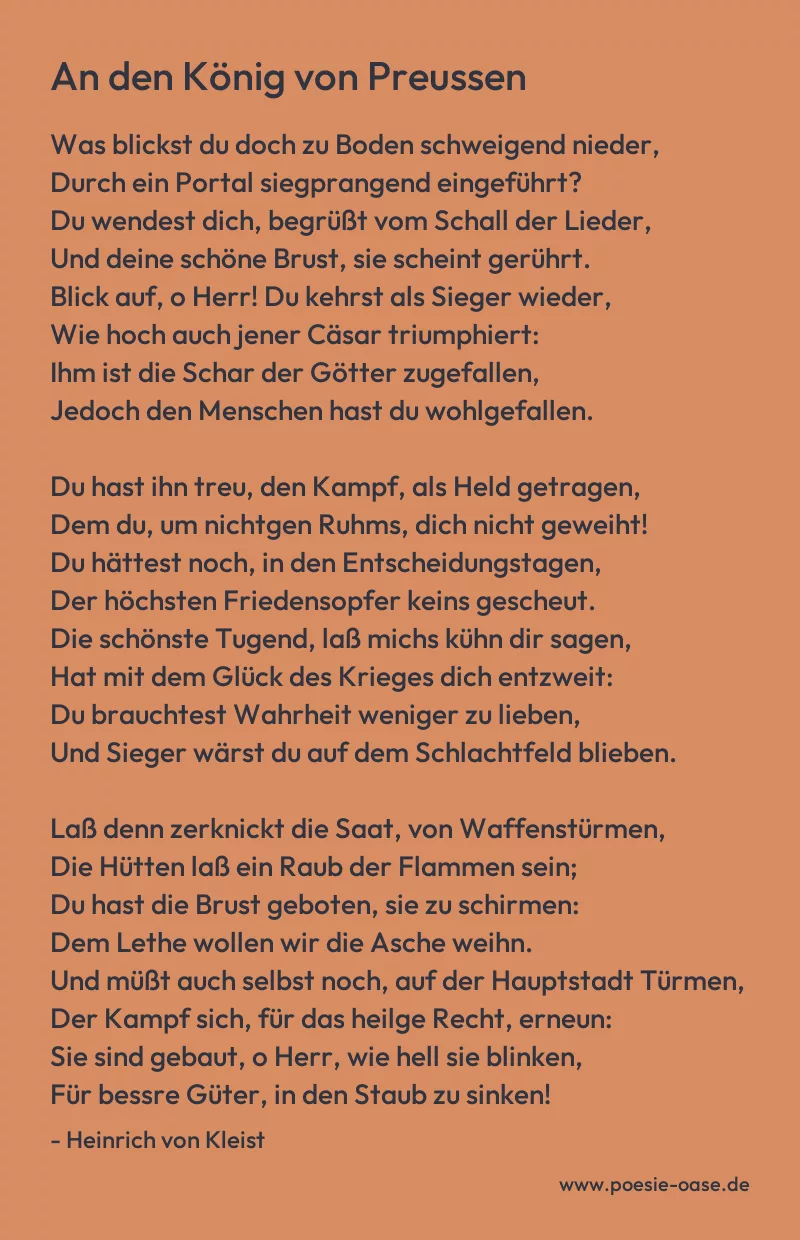
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den König von Preussen“ von Heinrich von Kleist ist eine ergreifende Auseinandersetzung mit der Rolle des Königs und den moralischen Implikationen des Krieges. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung des Königs, der nach einem Sieg durch ein Portal schreitet und von den Lobgesängen des Volkes empfangen wird. Kleist deutet jedoch subtil an, dass der König in dieser Situation zwiegespalten ist. Die „schöne Brust“ des Königs scheint gerührt, aber er blickt nieder, als ob er von der Schwere der Ereignisse überwältigt wäre.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die moralische Größe des Königs betont, indem er als Held dargestellt wird, der den Kampf „treu“ getragen hat, ohne sich dem reinen Ruhm zu verschreiben. Kleist suggeriert, dass der König in den entscheidenden Momenten sogar bereit gewesen wäre, Frieden zu schließen. Hier zeigt sich eine tiefe Wertschätzung für Tugend, die jedoch im Widerspruch zum Erfolg im Krieg steht. Die Zeilen „Du brauchtest Wahrheit weniger zu lieben, / Und Sieger wärst du auf dem Schlachtfeld blieben“ sind besonders bezeichnend. Sie legen nahe, dass der König seine moralischen Überzeugungen dem militärischen Erfolg geopfert hat.
Der letzte Teil des Gedichts ist von einer resignierten Hoffnung geprägt. Kleist akzeptiert die Zerstörung, die der Krieg gebracht hat – die zerknickte Saat, die brennenden Hütten. Dennoch ermutigt er den König, sich der Verantwortung für das, was geschehen ist, zu stellen. Die Hoffnung liegt in der Vision einer besseren Zukunft, in der die „heilgen Rechte“ verteidigt werden und die glorreichen Strukturen, die der König geschaffen hat, bereit sind, für diese höheren Werte zu fallen. Dies deutet auf ein tiefes Verständnis für die Tragödie des Krieges und die Opfer, die im Namen höherer Ideale gebracht werden müssen, hin.
Insgesamt ist das Gedicht eine komplexe Reflexion über Triumph, moralische Verantwortung und die Opfer, die im Krieg unvermeidlich sind. Es ist ein Appell an den König, sich der tragischen Natur seiner Rolle bewusst zu sein und sich für eine Zukunft einzusetzen, in der Frieden und Gerechtigkeit über militärische Siege gestellt werden. Kleist, als Zeitzeuge der napoleonischen Kriege, reflektiert hier über die Zerrissenheit, die mit der Führung eines Staates im Krieg verbunden ist und stellt die Frage nach den wahren Werten und dem Preis des Erfolgs.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.