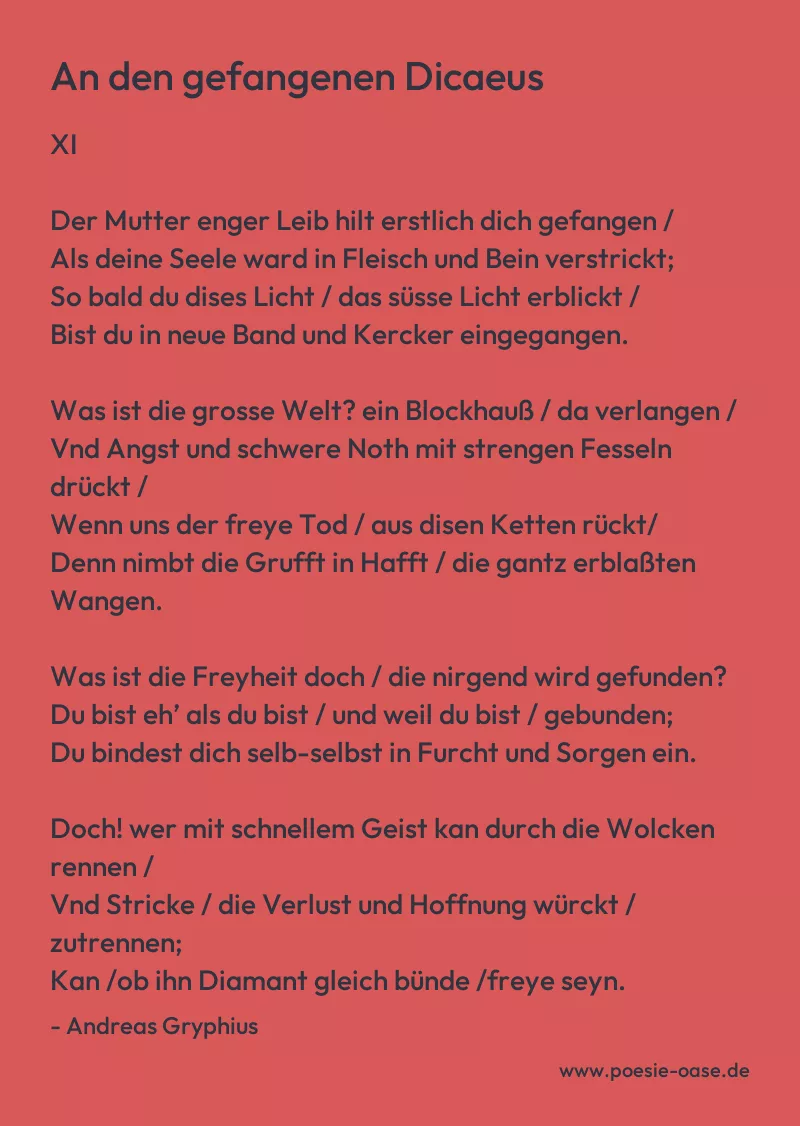An den gefangenen Dicaeus
XI
Der Mutter enger Leib hilt erstlich dich gefangen /
Als deine Seele ward in Fleisch und Bein verstrickt;
So bald du dises Licht / das süsse Licht erblickt /
Bist du in neue Band und Kercker eingegangen.
Was ist die grosse Welt? ein Blockhauß / da verlangen /
Vnd Angst und schwere Noth mit strengen Fesseln drückt /
Wenn uns der freye Tod / aus disen Ketten rückt/
Denn nimbt die Grufft in Hafft / die gantz erblaßten Wangen.
Was ist die Freyheit doch / die nirgend wird gefunden?
Du bist eh’ als du bist / und weil du bist / gebunden;
Du bindest dich selb-selbst in Furcht und Sorgen ein.
Doch! wer mit schnellem Geist kan durch die Wolcken rennen /
Vnd Stricke / die Verlust und Hoffnung würckt / zutrennen;
Kan /ob ihn Diamant gleich bünde /freye seyn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
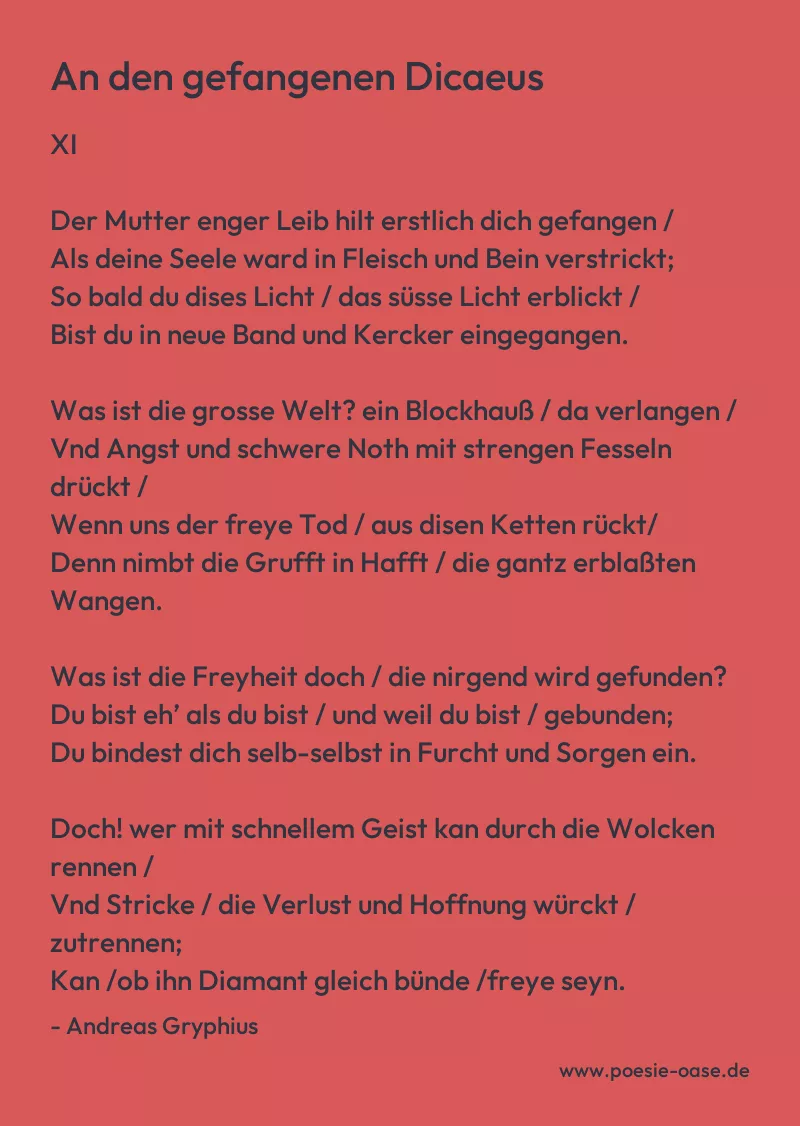
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den gefangenen Dicaeus“ von Andreas Gryphius entwirft ein düsteres Weltbild, das die menschliche Existenz als eine durchgängige Gefangenschaft darstellt. Bereits der Titel, der sich an eine hypothetische Person namens Dicaeus richtet, deutet auf eine allegorische Bedeutung der Gefangenschaft hin. Das Gedicht beginnt mit der Metapher der Geburt, die als erster Akt der Gefangennahme im Mutterleib beschrieben wird. Dieser erste Kerker wird durch die Welt selbst erweitert, die als „Blockhauß“ – also als ein Gefängnis aus Holz – charakterisiert wird, in dem „Verlangen, Und Angst und schwere Noth“ mit „strengen Fesseln“ den Menschen gefangen halten.
Der zweite Abschnitt des Gedichts führt die Frage nach der Freiheit auf. Gryphius stellt fest, dass die wahre Freiheit in der Welt nicht zu finden ist. Die Menschheit ist in einer Paradoxie gefangen: „Du bist eh‘ als du bist, und weil du bist, gebunden.“ Dies deutet auf eine Prädestination oder eine vorgegebene, unentrinnbare Verstrickung hin. Der Mensch ist von Geburt an bis zum Tod an das Leben und seine Bedingungen gefesselt. Die Freiheit wird hier als Illusion dargestellt, da die Menschen sich selbst durch „Furcht und Sorgen“ binden.
Die abschließende Strophe bietet jedoch einen Hoffnungsschimmer. Der „schnelle Geist“ – also der Verstand, der über die irdischen Begrenzungen hinausdenken kann – hat die Möglichkeit, die Fesseln der Welt zu durchbrechen. Indem er „durch die Wolcken rennt“ und die „Stricke, die Verlust und Hoffnung würckt, zutrennen“, kann der Mensch einen Weg zur Freiheit finden. Dies deutet auf eine spirituelle oder philosophische Freiheit hin, die unabhängig von den äußeren Umständen existieren kann.
Die zentrale Botschaft des Gedichts ist die Erkenntnis, dass die Welt ein Gefängnis ist und der Mensch von äußeren und inneren Kräften gefesselt wird. Wahre Freiheit ist jedoch nicht in der Welt, sondern im Geist zu finden. Gryphius betont die Notwendigkeit, über die irdischen Sorgen hinauszublicken und die Hoffnung auf eine höhere, transzendente Freiheit zu bewahren. Dies ist ein typisches Motiv der Barockliteratur, das die Vergänglichkeit des irdischen Lebens und die Suche nach Erlösung thematisiert. Die Verwendung von starken Bildern wie „Kercker“, „Fesseln“ und „Stricke“ verstärkt die Beklommenheit und die Hoffnungslosigkeit, während die Möglichkeit des „schnellen Geistes“ einen Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit bietet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.