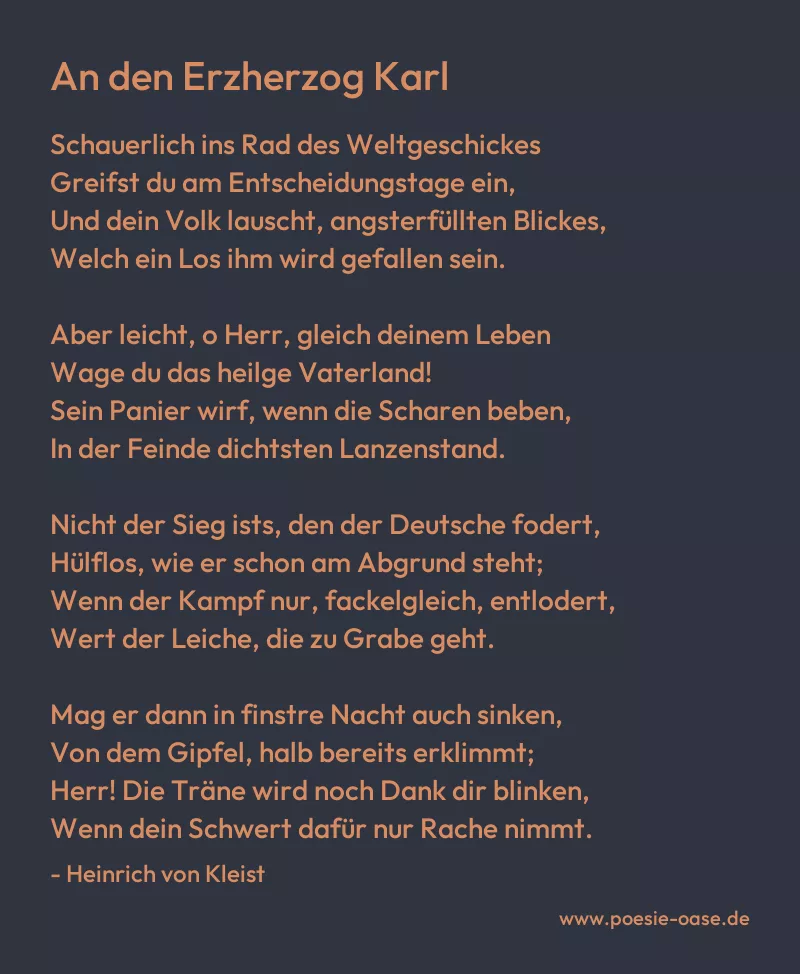An den Erzherzog Karl
Schauerlich ins Rad des Weltgeschickes
Greifst du am Entscheidungstage ein,
Und dein Volk lauscht, angsterfüllten Blickes,
Welch ein Los ihm wird gefallen sein.
Aber leicht, o Herr, gleich deinem Leben
Wage du das heilge Vaterland!
Sein Panier wirf, wenn die Scharen beben,
In der Feinde dichtsten Lanzenstand.
Nicht der Sieg ists, den der Deutsche fodert,
Hülflos, wie er schon am Abgrund steht;
Wenn der Kampf nur, fackelgleich, entlodert,
Wert der Leiche, die zu Grabe geht.
Mag er dann in finstre Nacht auch sinken,
Von dem Gipfel, halb bereits erklimmt;
Herr! Die Träne wird noch Dank dir blinken,
Wenn dein Schwert dafür nur Rache nimmt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
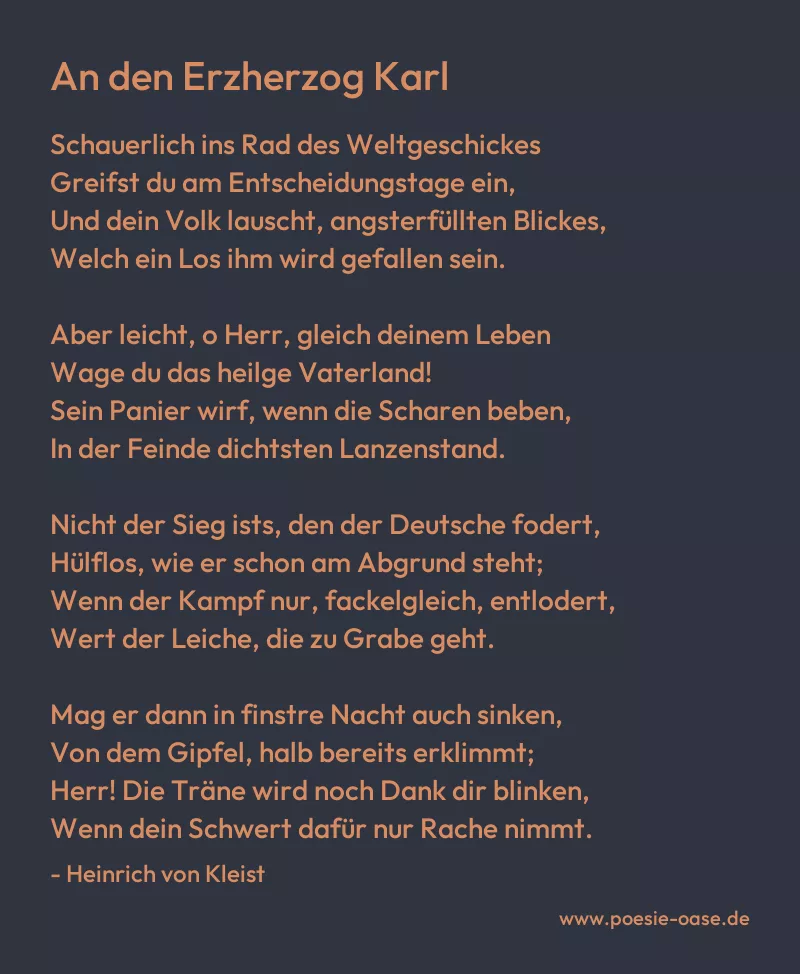
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Erzherzog Karl“ von Heinrich von Kleist ist eine pathetische Huldigung an den Feldherrn Erzherzog Karl von Österreich, die inmitten der napoleonischen Kriege entstanden ist. Es drückt eine tiefe Sorge um das Schicksal des deutschen Volkes aus und kombiniert die Dringlichkeit der militärischen Lage mit einem Gefühl der nationalen Würde und dem Wunsch nach heldenhaftem Widerstand, selbst wenn dies den Tod bedeutet. Kleist zeichnet hier ein Bild von Entschlossenheit und Opferbereitschaft, das in einer Zeit politischer Unsicherheit und militärischer Niederlagen als Aufruf zum Trotz dienen sollte.
Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung des Erzherzogs als einer Figur, die in das „Rad des Weltgeschickes“ eingreift, was auf seine zentrale Rolle in den bevorstehenden Schlachten anspielt. Das Volk beobachtet mit „angsterfüllten Blicken“, was auf die Ungewissheit und die drohenden Gefahren hindeutet. Kleist fordert den Erzherzog jedoch auf, sein „heilges Vaterland“ zu wagen, was die Überzeugung widerspiegelt, dass Tapferkeit und das Einsetzen für das Vaterland wichtiger sind als der kurzfristige Erfolg. Die Zeilen „Sein Panier wirf, wenn die Scharen beben, / In der Feinde dichtsten Lanzenstand“ befürworten mutigen Angriff, auch wenn dies mit Verlusten verbunden ist.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird die traditionelle Vorstellung des Sieges relativiert. Kleist behauptet, dass der Deutsche nicht primär den Sieg sucht, da das Volk bereits „am Abgrund steht“. Stattdessen wird der Kampf selbst glorifiziert, wobei er mit einer „Fackel“ verglichen wird, die hell lodert, selbst wenn der Tod die Konsequenz ist. Diese Haltung unterstreicht eine romantisch geprägte Wertschätzung von Opferbereitschaft und die Bereitschaft, für eine größere Idee zu sterben. Die letzten Strophen malen ein düsteres Bild des Scheiterns: Selbst wenn das Volk „in finstre Nacht auch sinken“ sollte, soll das „Schwert… Rache nehmen“.
Die Sprache des Gedichts ist pathetisch und voller starker Bilder, die die Dramatik der Situation unterstreichen. Kleist verwendet Metaphern wie das „Rad des Weltgeschickes“, das „heilge Vaterland“ und die „Fackel“, um die Emotionen zu verstärken und das Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. Die strenge Form der reimenden Verse, kombiniert mit den wiederkehrenden rhetorischen Fragen und Appellen, verleiht dem Gedicht eine mahnende und zugleich ermutigende Qualität. Es ist ein Zeugnis der tragischen Vision Kleists, die Hoffnung und Verzweiflung in einem poetischen Ausdruck vereint.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.