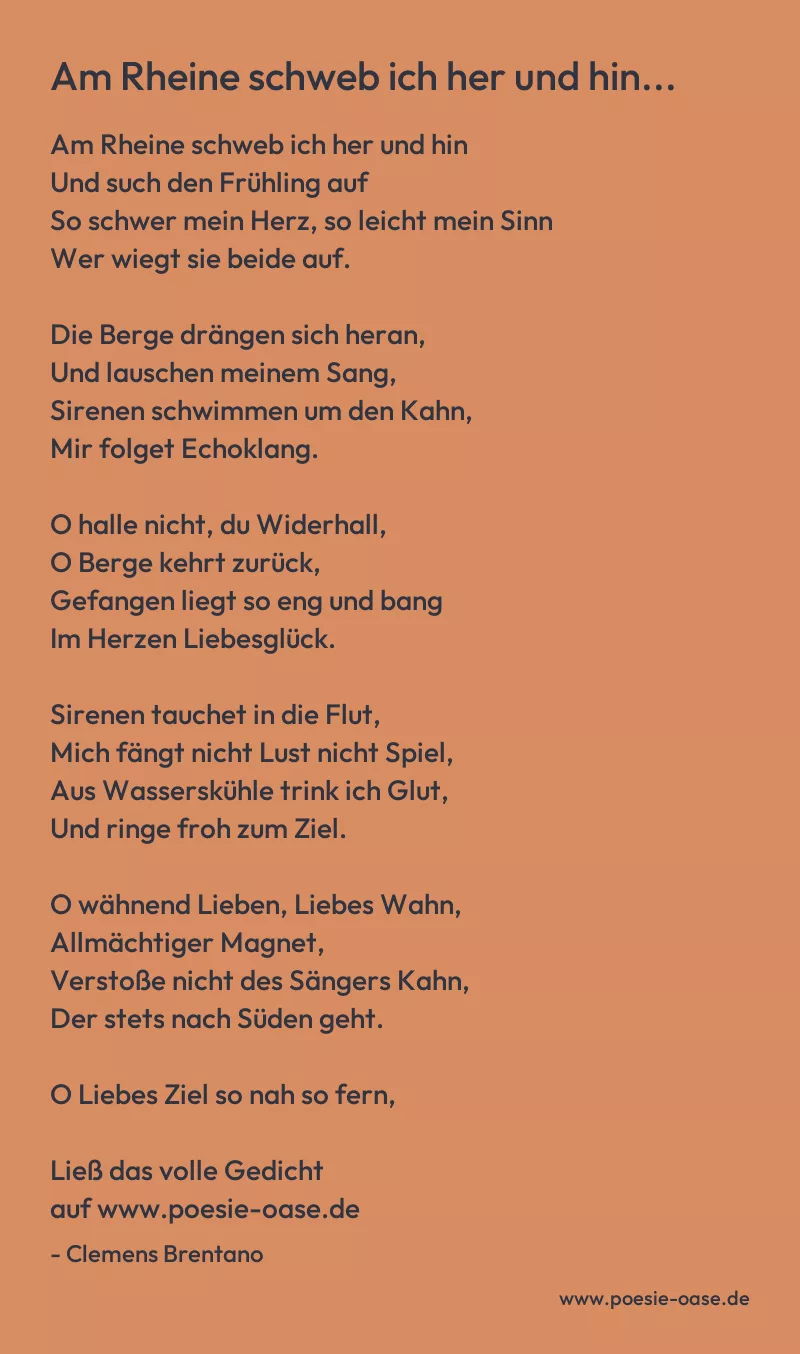Am Rheine schweb ich her und hin
Und such den Frühling auf
So schwer mein Herz, so leicht mein Sinn
Wer wiegt sie beide auf.
Die Berge drängen sich heran,
Und lauschen meinem Sang,
Sirenen schwimmen um den Kahn,
Mir folget Echoklang.
O halle nicht, du Widerhall,
O Berge kehrt zurück,
Gefangen liegt so eng und bang
Im Herzen Liebesglück.
Sirenen tauchet in die Flut,
Mich fängt nicht Lust nicht Spiel,
Aus Wasserskühle trink ich Glut,
Und ringe froh zum Ziel.
O wähnend Lieben, Liebes Wahn,
Allmächtiger Magnet,
Verstoße nicht des Sängers Kahn,
Der stets nach Süden geht.
O Liebes Ziel so nah so fern,
Ich hole dich noch ein,
Die Frommen führt der Morgenstern,
Ja all zum Krippelein.
Geweihtes Kind erlöse mich,
Gib meine Freude los,
Süß Blümlein ich erkenne dich,
Du blühest mir mein Los,
In Frühlingsauen sah mein Traum
Dich Glockenblümlein stehn,
Vom blauen Kelch zum goldnen Saum,
Hab ich zu viel gesehn,
Du blauer Liebeskelch in dich
Sank all mein Frühling hin,
Vergifte mich, umdüfte mich,
Weil ich dein eigen bin.
Und schließest du den Kelch mir zu
Wie Blumen abends tun,
So lasse mich die letzte Ruh
Zu deinen Füßen ruhn.