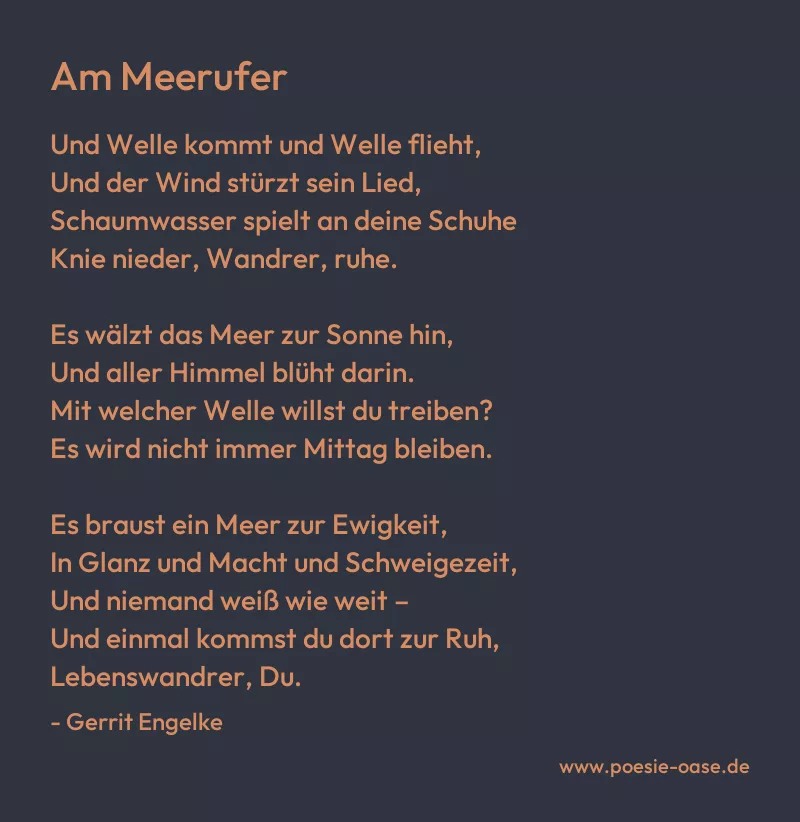Am Meerufer
Und Welle kommt und Welle flieht,
Und der Wind stürzt sein Lied,
Schaumwasser spielt an deine Schuhe
Knie nieder, Wandrer, ruhe.
Es wälzt das Meer zur Sonne hin,
Und aller Himmel blüht darin.
Mit welcher Welle willst du treiben?
Es wird nicht immer Mittag bleiben.
Es braust ein Meer zur Ewigkeit,
In Glanz und Macht und Schweigezeit,
Und niemand weiß wie weit –
Und einmal kommst du dort zur Ruh,
Lebenswandrer, Du.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
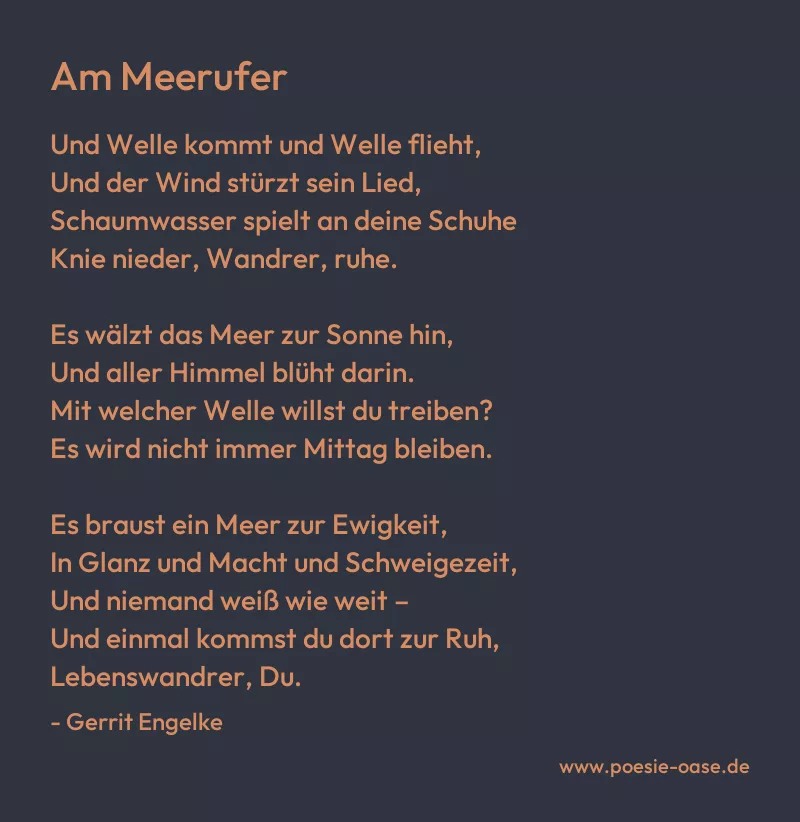
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Am Meerufer“ von Gerrit Engelke ist eine kurze, eindringliche Reflexion über die Vergänglichkeit des Lebens und die Unendlichkeit des Todes, eingebettet in eine Naturmetapher. Das Meer, mit seinem steten Wechsel von Kommen und Gehen, wird zum Spiegelbild des menschlichen Daseins, während der Wind und die Sonne die Atmosphäre von Ruhe und gleichzeitig von Unbeständigkeit prägen. Der Dichter lädt den „Wandrer“ ein, innezuhalten und die Schönheit der Gegenwart zu genießen, gleichzeitig aber die Endlichkeit des irdischen Daseins zu akzeptieren.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt die unmittelbare Erfahrung am Meerufer. Die sich wiederholende Bewegung der Wellen und das Spiel des Windes schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und des Einklangs mit der Natur. Die Aufforderung „Knie nieder, Wandrer, ruhe“ fordert den Leser auf, im Moment zu verweilen und die Schönheit der Umgebung zu genießen. Die spielerische Interaktion von Wasser und Füßen des Wanderers wirkt fast wie eine Einladung, sich der Natur anzuvertrauen. Zugleich liegt in der sanften Bewegung der Wellen, die „fliehen“, bereits eine subtile Andeutung von Abschied und Vergänglichkeit.
Der zweite Teil erweitert die Perspektive und lenkt den Blick auf die Weite des Himmels und die Unendlichkeit des Meeres. Der „Glanz“ der Sonne und des Himmels, die in den Wellen widergespiegelt werden, symbolisieren die Schönheit und Faszination des Lebens. Doch gleichzeitig mahnt die Frage „Mit welcher Welle willst du treiben? / Es wird nicht immer Mittag bleiben“ die Vergänglichkeit dieser Schönheit an. Die Metapher des Meeres, das zur Ewigkeit braust, unterstreicht die tiefe Einsicht in die begrenzte Zeit des Menschen im Angesicht des Unendlichen.
Die letzten Verse verbinden die Erfahrung der Gegenwart mit der Ahnung des Todes. Das Meer, das zuvor als Spielplatz und Spiegel der Schönheit diente, wird nun zum Ort der Ruhe, der „Schweigezeit“. Die Gewissheit des Todes, die im Satz „Und einmal kommst du dort zur Ruh, / Lebenswandrer, Du“ ausgesprochen wird, ist jedoch nicht als düstere Klage, sondern als Akzeptanz eines natürlichen Kreislaufs zu verstehen. Das Gedicht findet seinen Abschluss in einer gelassenen Betrachtung des Lebensweges, des Wanderns, das letztlich in die ewige Ruhe mündet. Die Natur dient hier als Metapher für das Leben und seinen unaufhaltsamen Gang, in dem Schönheit und Vergänglichkeit untrennbar miteinander verbunden sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.