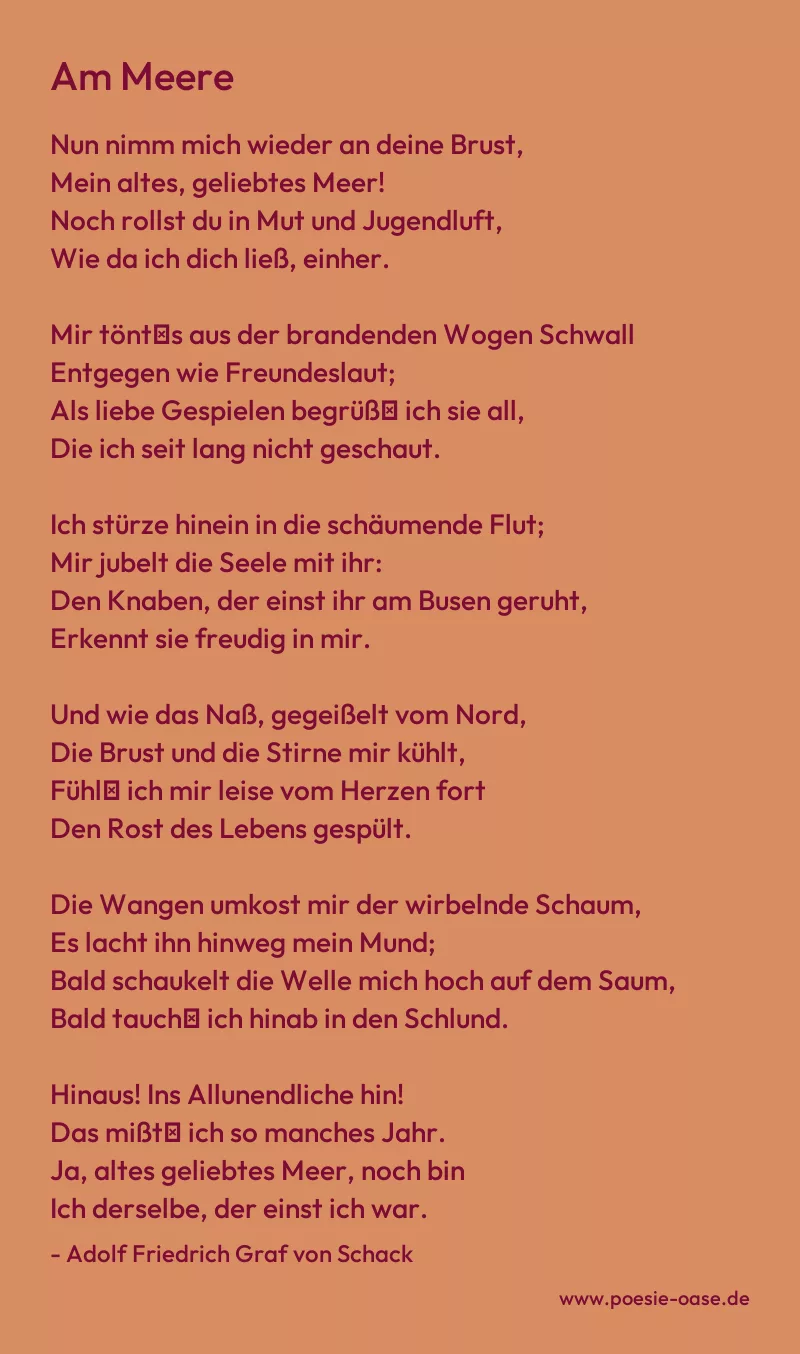Am Meere
Nun nimm mich wieder an deine Brust,
Mein altes, geliebtes Meer!
Noch rollst du in Mut und Jugendluft,
Wie da ich dich ließ, einher.
Mir tönt′s aus der brandenden Wogen Schwall
Entgegen wie Freundeslaut;
Als liebe Gespielen begrüß′ ich sie all,
Die ich seit lang nicht geschaut.
Ich stürze hinein in die schäumende Flut;
Mir jubelt die Seele mit ihr:
Den Knaben, der einst ihr am Busen geruht,
Erkennt sie freudig in mir.
Und wie das Naß, gegeißelt vom Nord,
Die Brust und die Stirne mir kühlt,
Fühl′ ich mir leise vom Herzen fort
Den Rost des Lebens gespült.
Die Wangen umkost mir der wirbelnde Schaum,
Es lacht ihn hinweg mein Mund;
Bald schaukelt die Welle mich hoch auf dem Saum,
Bald tauch′ ich hinab in den Schlund.
Hinaus! Ins Allunendliche hin!
Das mißt′ ich so manches Jahr.
Ja, altes geliebtes Meer, noch bin
Ich derselbe, der einst ich war.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
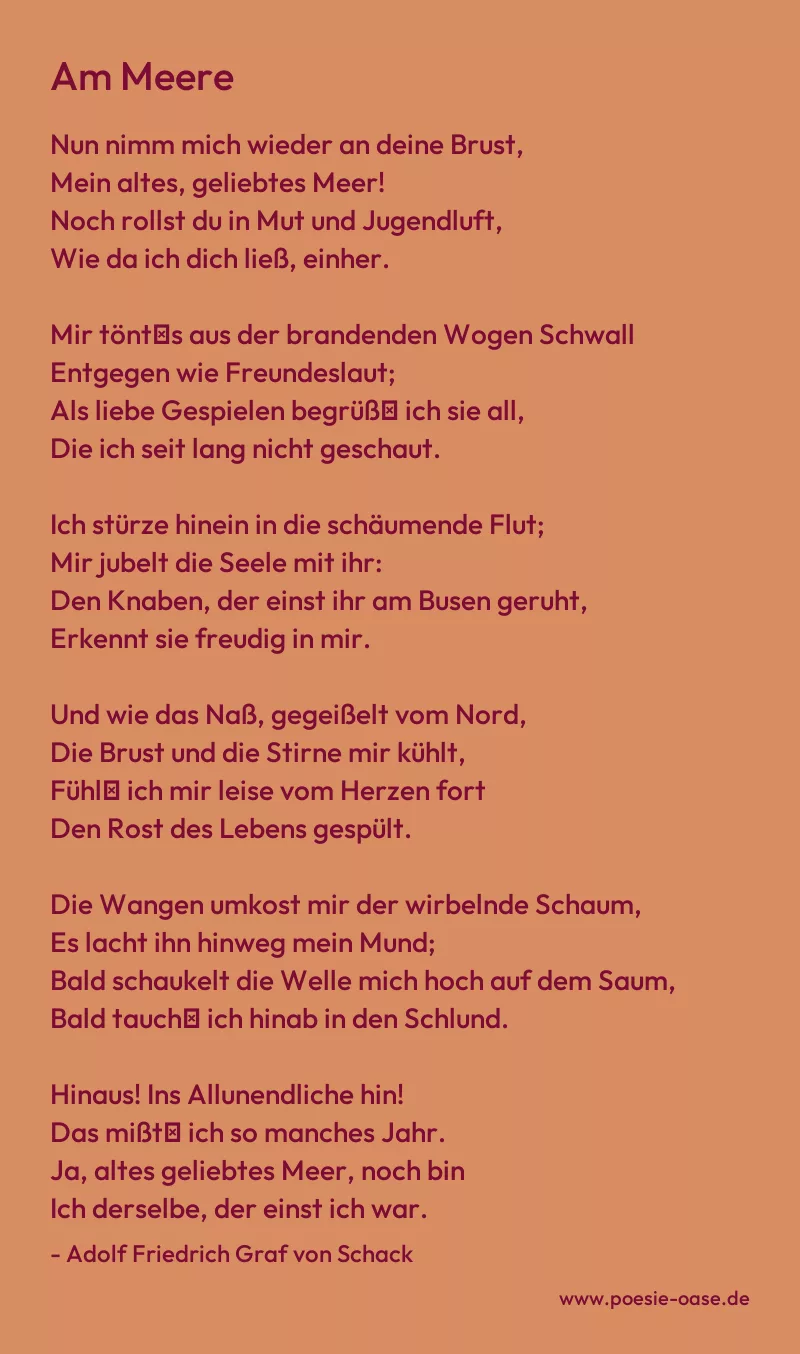
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Am Meere“ von Adolf Friedrich Graf von Schack ist eine tiefe Reflexion über die Sehnsucht nach Einheit mit der Natur, genauer gesagt mit dem Meer, und die damit verbundene Reinigung und Wiedergeburt des Ichs. Das lyrische Ich kehrt nach längerer Abwesenheit zum Meer zurück, das als Metapher für eine unberührte, jugendliche und befreiende Urkraft steht. Die Wiederbegegnung löst ein Gefühl des Heimkommens und der Vertrautheit aus, was durch die Anrede „Mein altes, geliebtes Meer!“ gleich am Anfang deutlich wird. Der Dichter identifiziert sich mit der ewigen Jugend des Meeres, während er gleichzeitig die Spuren der Zeit und die Last des Lebens, den „Rost des Lebens“, in sich spürt.
Das Gedicht ist durchzogen von einer intensiven körperlichen Erfahrung, die durch die sinnliche Wahrnehmung des Meeres und der Elemente erzeugt wird. Das lyrische Ich nimmt das Rauschen der Wellen als Freundesruf wahr, „die ich seit lang nicht geschaut“. Das Eintauchen in die Fluten wird als eine freudige Vereinigung mit dem Meer beschrieben. Die körperliche Berührung des Wassers, das die Wangen umkost, und das Auf und Ab der Wellen werden als reinigend und belebend empfunden. Diese physische Erfahrung führt zu einem emotionalen und spirituellen Zustand der Befreiung, der durch das Wegspülen des „Rosts des Lebens“ aus dem Herzen symbolisiert wird.
Die Metapher des Meeres dient als Spiegelbild des eigenen Selbst, in dem das lyrische Ich sich wiedererkennt und seine ursprüngliche Identität bestätigt findet. Das Meer als ewige Instanz des Wandels und der Erneuerung ermöglicht es dem lyrischen Ich, sich von den Beschwernissen des Lebens zu befreien und zu seiner ursprünglichen, unschuldigen Natur zurückzukehren. Das Gedicht gipfelt in der Gewissheit, dass der Dichter, trotz der vergangenen Jahre und Erfahrungen, im Wesentlichen derselbe geblieben ist, was die ewige Verbindung zwischen dem Ich und der Natur unterstreicht. Die Sehnsucht nach dem „Allunendlichen“ deutet auf ein Verlangen nach Transzendenz hin, nach einer Verschmelzung mit dem Universum, die im Meer als dem Inbegriff des Unendlichen ihre Erfüllung findet.
Die Sprache des Gedichts ist klar und direkt, geprägt von einer liebevollen Zuwendung zum Detail und einer bildhaften Darstellung der Natur. Die Verwendung von Adjektiven wie „altes“, „geliebtes“, „brandenden“ und „schäumende“ unterstreicht die emotionale Verbundenheit des Dichters mit dem Meer. Der Wechsel zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Rhythmus der Wellen spiegelt die innere Zerrissenheit und das Gleichgewicht zwischen Freude und Sehnsucht wider. Die Wiederholung des „Ich“ und die direkte Anrede an das Meer verstärken die intime Atmosphäre und die zentrale Bedeutung der persönlichen Erfahrung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.