Mutter Anne und Hanne,
Mutter Camille und Sibille,
Frau Murksen, Frau Mucksen,
Frau Drucksen, Frau Luxen,
Die saßen zusammen an einem Tage.
Da begann Frau Murksen mit dieser Klage:
′s ist doch viel Not in der Welt, Mutter Hanne!
– Ja, ja, Frau Murksen, das Bier kost sieben Kreuzer die Kanne!
Und das liebe Geld ist so rar,
Wies noch gar in der Welt nicht war!
Nur dummes Volk hat die Taschen voll,
Und Glück hat niemand, der es haben soll!
– Ja, ja, Frau Hanne, das ist sehr wahr
Und ward mir an mir selber klar.
Mir träumte heut nacht, ich würde zum Peterberge
Geführt von einem kleinen allerliebsten niedlichen Zwerge.
Der sagte: Was fragt Ihr nach roten Dreiern:
Hier sitzt eine goldne Gans auf goldnen Eiern.
Das Peterbild zeigt mit der Hand,
Wo man sie suchen muß im Sand.
Da sah ich, wie das Bild sich neigte
Und mir die Gans im Sande zeigte.
Ich grub sie mit allen Eiern aus
Und trug sie, versteht sich im Traum, nach Haus.
Nun aber erwacht ich wieder
Vom Schlaf und rieb mir die Augenlider,
Stand auf und lief in aller Frühe
Und sucht das Bild mit großer Mühe.
Ich fand es; aber, daß Gott erbarm!
Dem Bilde fehlte der rechte Arm:
Es zeigte nicht mehr! Ich wußte nicht wo
Ich graben sollte und – ließ es so! –
– Ach, sprach Mutter Hanne, das sind ja nur Träume,
Und Träume sind Schäume!
Ich glaube wenig an solche Zwerge;
Auch sitzt die Gans nicht im Peterberge:
Sie sitzt bei Mansfeld versteckt vor der Sonne
Und dicht dabei das Bild von einer Nonne.
Wo das hin sieht, wird die Gans gefunden.
Doch sind dem Bilde die Augen verbunden,
Und keiner merkts wohin es blickt.
Das macht die Leute dort bald verrückt.
Die Binde von Stein läßt sich nicht schieben;
So ist das Finden noch unterblieben. –
– Da sprach Frau Camilla: Was Nonnengesicht!
Die Gans sitzt auch in Mansfeld nicht:
In Farnstedt hat sie gesessen einmal,
Im Nonnenkloster am wüsten Saal:
Da fand sie ein frommer Jesuit,
Der fing sie sich ein und nahm sie mit.
Es war ein Mensch von Sünden rein,
Was wir dermalen all nicht sein! –
– Nun, sprach Frau Drucksen, ich will nicht streiten,
Daß da eine Gans saß vor alten Zeiten:
Dann aber ließ eine neue sich wieder
Um die Kapelle bei Landsberg nieder.
Da sitzt sie noch auf goldnen Eiern,
Wie alle Leute dort beteuern. –
– Jetzt räusperte sich Frau Mucksen und spricht:
O liebe Frau Drucksen, da sitzt sie nicht!
Nach Gibichenstein da führt ein Gang,
Der Gang ist finster und schmählich lang:
Da sitzt sie, aber hinten am Ende!
Und ist keine Gans nicht, es ist eine Ente.
Das sagen in Halle alle Leute;
Ich selber weiß es ja noch wie heute.
Es gingen drei Weiber von Halloren
In dem langen Gange beinah verloren.
Die wollten sie suchen mit einem Lichte,
Allein das bliesen aus die Wichte,
Sie aber tappten im Dunkel nach Hause
Und dankten Gott in der Moritz-Klause
Für die Erlösung aus Angst und Bangen:
Man sieht noch ihre drei Jacken hangen. –
– Da schluckte Frau Luxen hinab ihre Semmel
Und sprach und rückte mit dem Schemmel:
Frau Mucksen hat wohl recht mit der Ente
Und sagts so richtig, als ichs nur könnte;
Doch das mit den Jacken sind nur Mären,
Womit die Halloren die Weiber scheeren.
Auch sitzt die Ente nicht in dem Gange,
Die sitzt wo anders, wer weiß wie lange! –
– Und wo denn wohl? – Sie sitzt gemach
Bei Eisleben, zu Sittichenbach,
Unter dem Deichtenn, im faulen Stocke,
Und brütet auf einem ganzen Schocke
Und, kriecht keins aus, so legt sie in Ruh
Immer wieder ein neues hinzu. –
– Das ärgert endlich Frau Sibille,
Sie schwieg ohnedem zu lange stille:
Frau Luxen, bei meinem Haubenstocke,
Ihr übertreibts mit eurem Schocke!
Der Eier sind dreizehn, nicht mehr, nicht minder,
Wollt ihrs nicht glauben, so fragt die Kinder.
Und die Ente sitzt, das wissen hier alle,
Und schnattert im Gutenberg bei Halle.
– Nun, wißt ihr die Örter, Frau Gevattern,
Wo solche goldne Enten schnattern,
Warum wollt ihr die Eier nicht ergattern?
– Es war schon lange Zeit mein Wille,
Entgegnete Frau Murksen Frau Sibille,
Allein mir fehlts an einem Zwerge,
Der mir wie euch Anweisung gäb im Berge.
Altweibergespräch
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
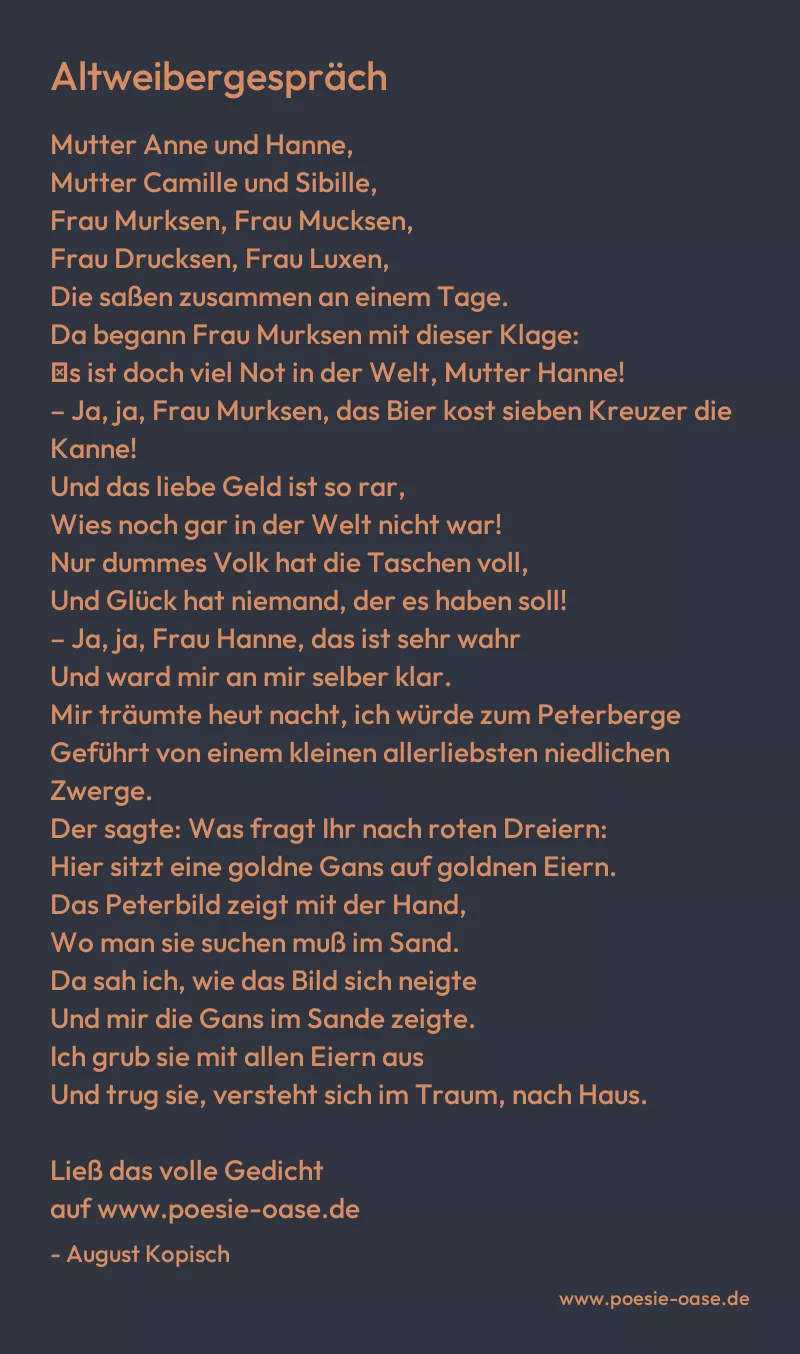
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Altweibergespräch“ von August Kopisch ist eine humorvolle und satirische Darstellung eines Gesprächs zwischen mehreren alten Frauen, die sich über die Suche nach einer mysteriösen, goldenen Gans austauschen. Das Gedicht zeichnet sich durch seinen mundartlichen Ton, die Verwendung von Dialekt und die lebhaften Beschreibungen der einzelnen Charaktere aus, die durch ihre unterschiedlichen Meinungen und die Vielfalt ihrer Geschichten zum Ausdruck kommen.
Die Frauen beginnen ihren Austausch mit einer Klage über die schlechte Welt, das teure Bier und das fehlende Geld. Diese anfängliche Klage, die von Frau Murksen geäußert wird, dient als Ausgangspunkt für die Erzählungen über die Gans. Jede Frau hat ihre eigene Version, wo sich die Gans befindet, und jede Geschichte wird mit einer gewissen Überzeugung und Detailreichtum erzählt, wobei sich die Erzählungen im Laufe des Gedichts immer weiter verkomplizieren und absurder werden. Von Träumen über Zwerge bis hin zu Jesuiten, Klöstern und unterirdischen Gängen – die Geschichten der Frauen nehmen groteske Züge an.
Die Struktur des Gedichts, die durch die Dialogform entsteht, lässt die Zuhörer in die Welt der Frauen eintauchen. Die Reaktion der anderen Frauen auf die Erzählungen einer jeden, sowohl in Form von zustimmenden oder widersprechenden Kommentaren, als auch in der Erwiderung mit einer eigenen Geschichte, unterstreicht die Lebendigkeit des Gedichts. Das Gedicht zeigt auch die menschliche Tendenz zur Spekulation und zur Verbreitung von Gerüchten, da jede Frau fest an ihre Version der Wahrheit glaubt und diese verteidigt. Der Autor benutzt dieses Mittel, um die Absurdität und die leere Natur derartiger Diskussionen aufzuzeigen.
Das Gedicht endet mit einer leichten Ironie, als Frau Murksen feststellt, dass ihr ein „Zwerg“ fehlt, der ihr den Weg zur Gans weisen könnte. Dies unterstreicht die Sinnlosigkeit des ganzen Gespräches und die Unfähigkeit, eine tatsächliche Lösung zu finden. Das Gedicht ist somit eine humorvolle Kritik an Geschwätz, unbegründeten Behauptungen und der menschlichen Neigung, Gerüchten zu glauben und ihnen nachzueifern, anstatt sich auf Fakten zu verlassen. Die abschließende Frage nach dem „Zwerg“ deutet auf die Schwierigkeit hin, echte Antworten zu finden, wenn man sich auf derartige Quellen verlässt.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
