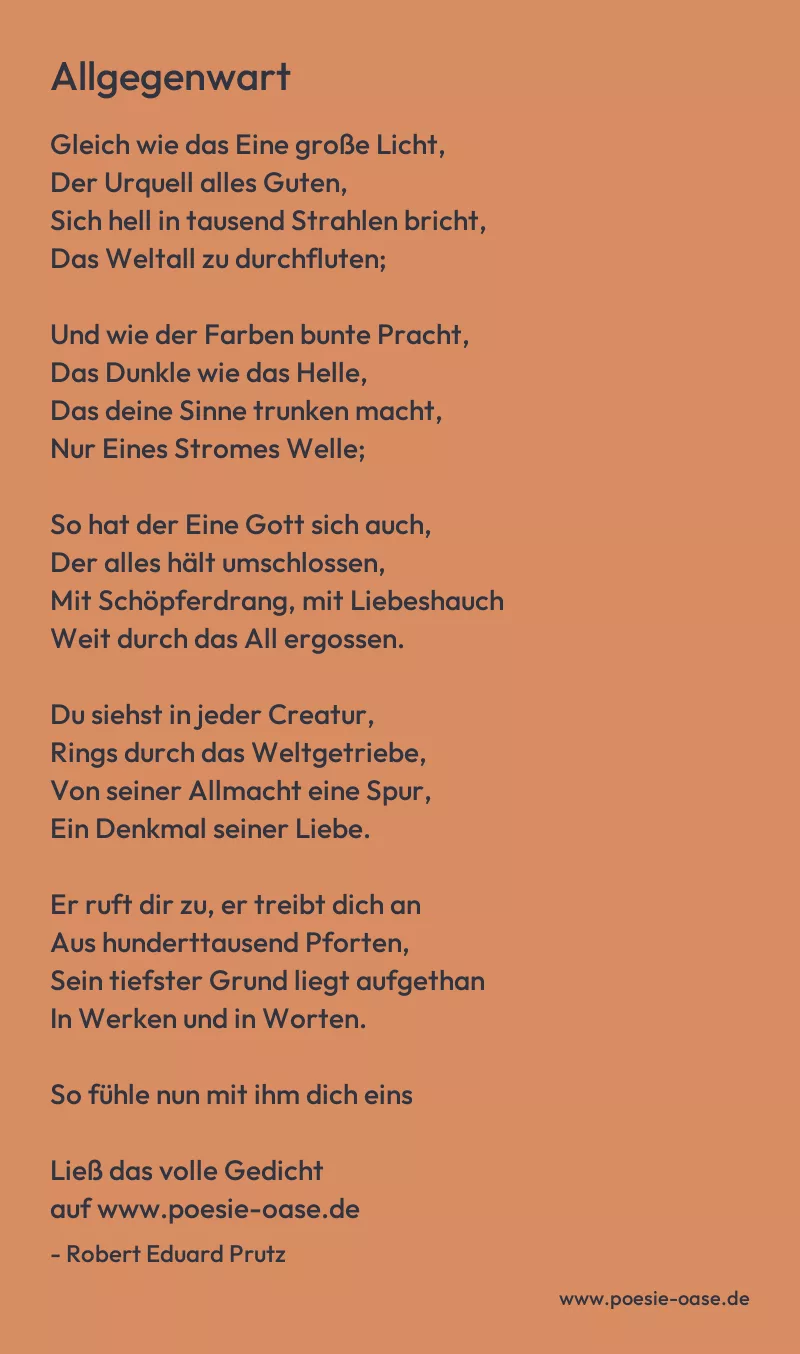Gleich wie das Eine große Licht,
Der Urquell alles Guten,
Sich hell in tausend Strahlen bricht,
Das Weltall zu durchfluten;
Und wie der Farben bunte Pracht,
Das Dunkle wie das Helle,
Das deine Sinne trunken macht,
Nur Eines Stromes Welle;
So hat der Eine Gott sich auch,
Der alles hält umschlossen,
Mit Schöpferdrang, mit Liebeshauch
Weit durch das All ergossen.
Du siehst in jeder Creatur,
Rings durch das Weltgetriebe,
Von seiner Allmacht eine Spur,
Ein Denkmal seiner Liebe.
Er ruft dir zu, er treibt dich an
Aus hunderttausend Pforten,
Sein tiefster Grund liegt aufgethan
In Werken und in Worten.
So fühle nun mit ihm dich eins
Und eins mit allem Leben,
So wirst du in der Flut des Seins
Als Tropfen gern verschweben.
In jeder Blume, jedem Stern
Erblickst du Gottes Zeichen.
In jeder Seele nah und fern
Erkennst du deinesgleichen.
Und wie der Schöpfung großer Ring
In innigstem Vereine
Umschlossen hält jedwedes Ding,
Das Große wie das Kleine:
So halte du in Liebe auch
Den Himmel wie die Erde,
Daß deines Athems schwacher Hauch
Ein Sturmwind Gottes werde:
Allüberall ein einzig Meer
Der Liebe zu entzünden,
Und laut durch Thaten ringsumher
Den Ew′gen zu verkünden!