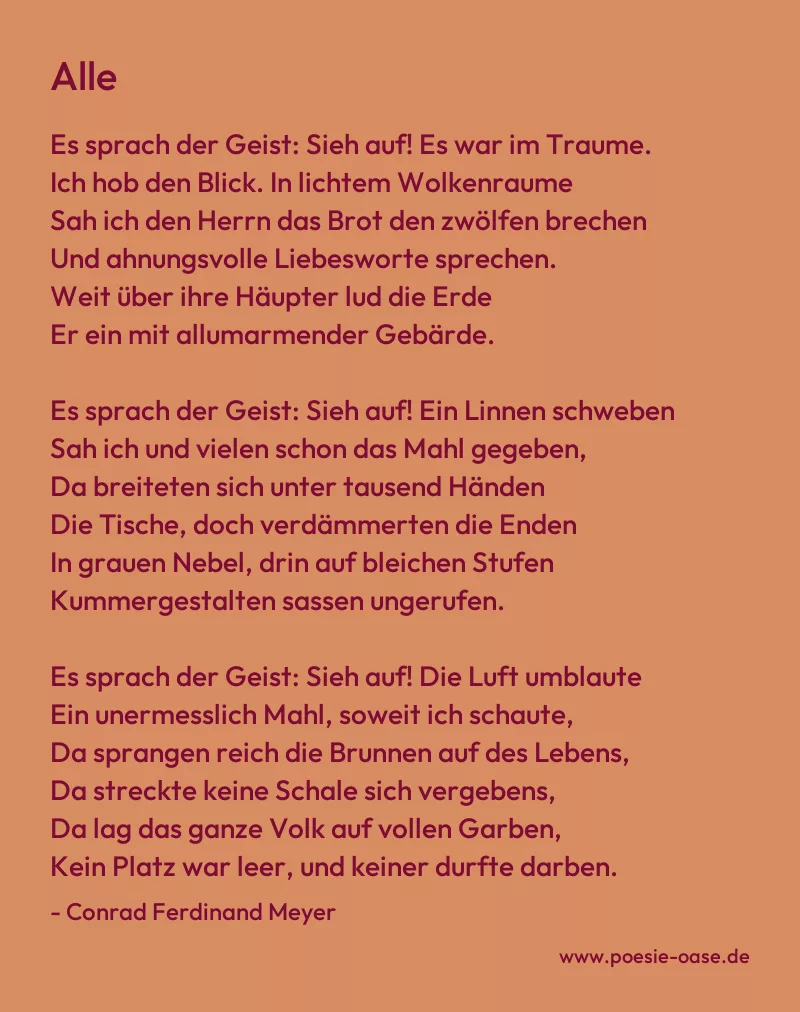Alle
Es sprach der Geist: Sieh auf! Es war im Traume.
Ich hob den Blick. In lichtem Wolkenraume
Sah ich den Herrn das Brot den zwölfen brechen
Und ahnungsvolle Liebesworte sprechen.
Weit über ihre Häupter lud die Erde
Er ein mit allumarmender Gebärde.
Es sprach der Geist: Sieh auf! Ein Linnen schweben
Sah ich und vielen schon das Mahl gegeben,
Da breiteten sich unter tausend Händen
Die Tische, doch verdämmerten die Enden
In grauen Nebel, drin auf bleichen Stufen
Kummergestalten sassen ungerufen.
Es sprach der Geist: Sieh auf! Die Luft umblaute
Ein unermesslich Mahl, soweit ich schaute,
Da sprangen reich die Brunnen auf des Lebens,
Da streckte keine Schale sich vergebens,
Da lag das ganze Volk auf vollen Garben,
Kein Platz war leer, und keiner durfte darben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
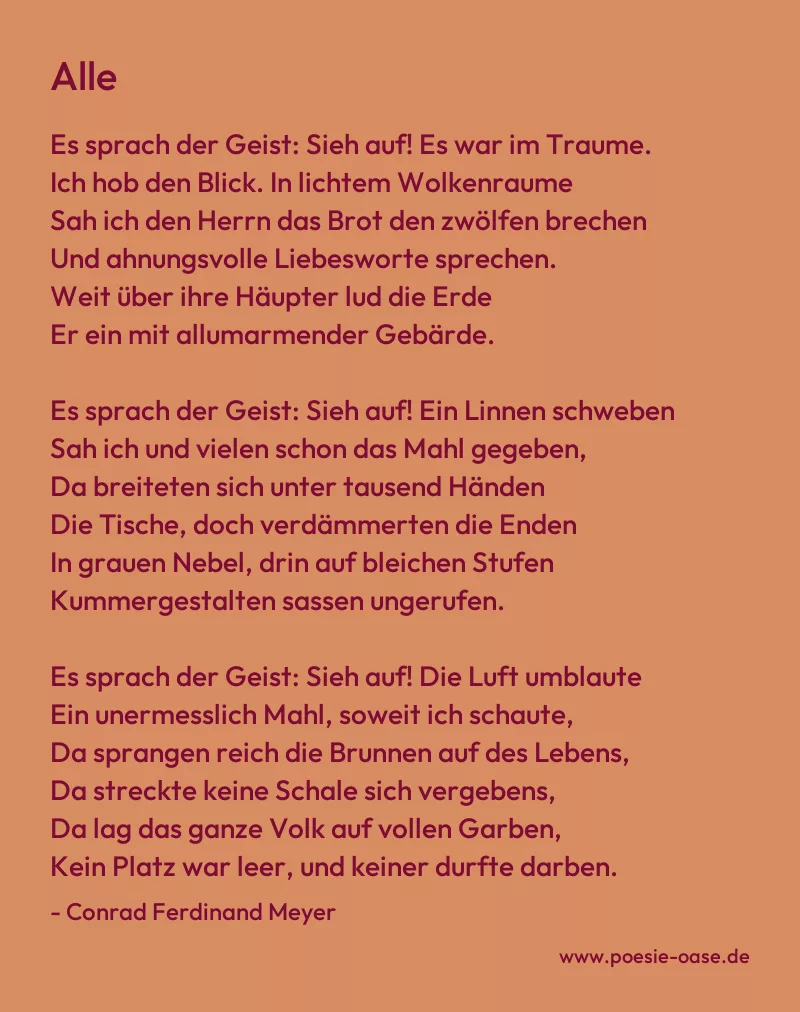
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Alle“ von Conrad Ferdinand Meyer ist eine mystische Vision, die in drei Strophen die Entwicklung einer universellen Teilhabe an einem festlichen Mahl beschreibt. Der Geist, als eine Art Erzähler oder innerer Beobachter, fordert den Betrachter wiederholt auf, seine Augen zu erheben und die verschiedenen Phasen dieser Vision zu betrachten. Das Gedicht bewegt sich von der intimen Runde der zwölf Jünger Jesu hin zu einer immer umfassenderen Gemeinschaft, um schließlich in einer universalen Fülle zu kulminieren.
Die erste Strophe beschreibt ein frühes Stadium: Jesus teilt das Brot mit den Jüngern und spricht von Liebe. Das Bild der zwölf Jünger deutet auf eine begrenzte Gemeinschaft hin, eine ausgewählte Gruppe. Die „allumarmende Gebärde“ Jesu, mit der er die Erde einlädt, lässt jedoch bereits eine erweiterte Perspektive erahnen. Diese erste Szene etabliert einen christlichen Bezug und die Bedeutung von Liebe und Teilen als Grundlage der nachfolgenden Visionen.
Die zweite Strophe erweitert die Szenerie: Das Mahl wird an eine größere Gruppe gegeben. Der Nebel, der die Enden der Tische verdämmert, und die „Kummergestalten“, die ungerufen sitzen, suggerieren eine Phase der Unvollkommenheit und des Leidens. Hier sind nicht alle Teil der Feier; es gibt Ausgeschlossene und Unzufriedene. Dieser Abschnitt des Gedichts scheint die menschliche Erfahrung von Ungerechtigkeit und ungestilltem Hunger nach Gemeinschaft widerzuspiegeln.
Die dritte und letzte Strophe erreicht schließlich den Höhepunkt der Vision. Die Atmosphäre ist aufgeladen von einer grenzenlosen Fülle. „Ein unermesslich Mahl“, reich sprudelnde Brunnen und eine Gesellschaft, in der niemand hungern muss, beschreiben eine ideale, harmonische Welt. Die Abwesenheit von Leere und Not deutet auf eine Utopie hin, in der alle Menschen gleichermaßen an den Gaben des Lebens teilhaben können. Meyer malt hier das Bild einer vollendeten Harmonie und universellen Teilhabe.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.