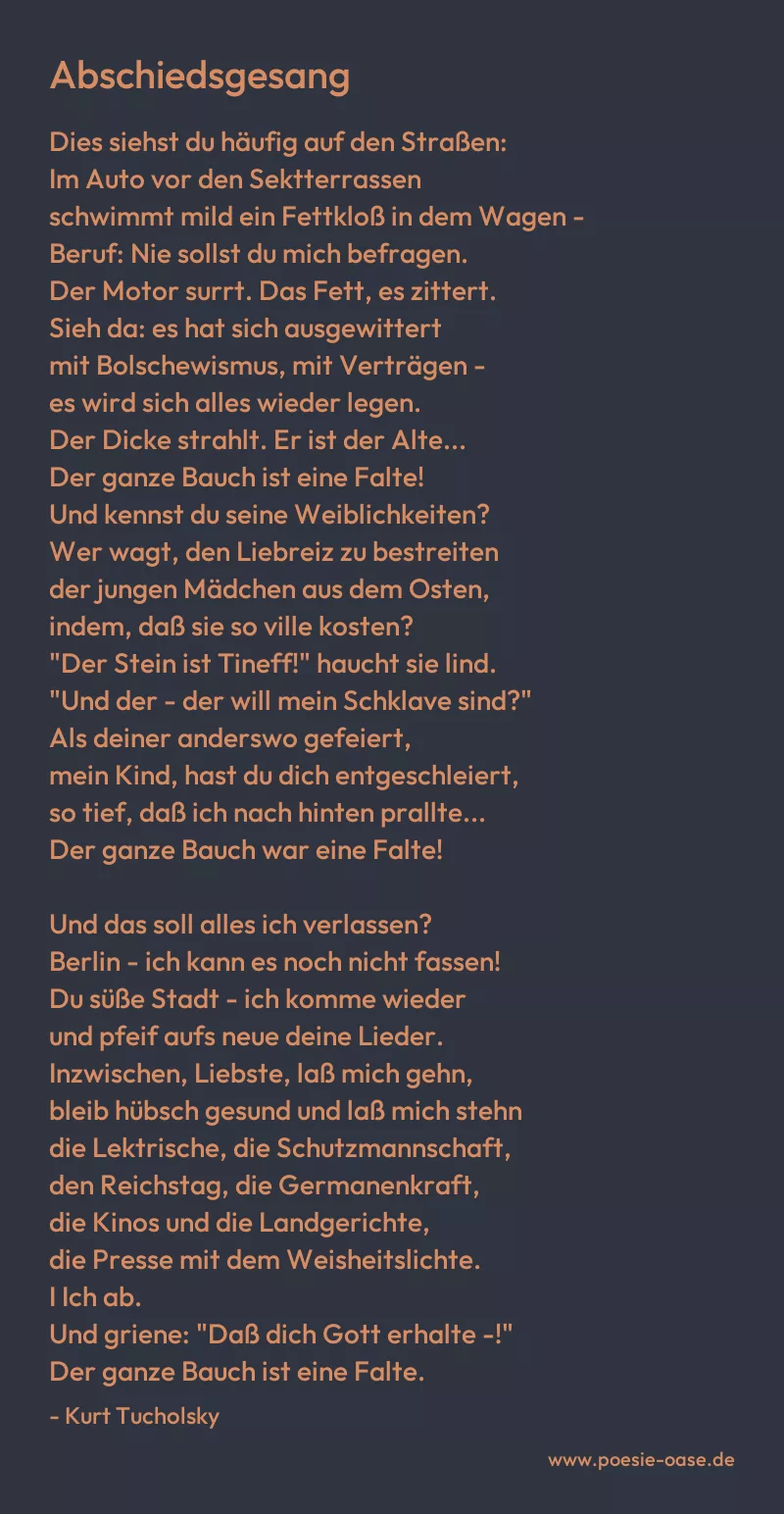Abschiedsgesang
Dies siehst du häufig auf den Straßen:
Im Auto vor den Sektterrassen
schwimmt mild ein Fettkloß in dem Wagen –
Beruf: Nie sollst du mich befragen.
Der Motor surrt. Das Fett, es zittert.
Sieh da: es hat sich ausgewittert
mit Bolschewismus, mit Verträgen –
es wird sich alles wieder legen.
Der Dicke strahlt. Er ist der Alte…
Der ganze Bauch ist eine Falte!
Und kennst du seine Weiblichkeiten?
Wer wagt, den Liebreiz zu bestreiten
der jungen Mädchen aus dem Osten,
indem, daß sie so ville kosten?
„Der Stein ist Tineff!“ haucht sie lind.
„Und der – der will mein Schklave sind?“
Als deiner anderswo gefeiert,
mein Kind, hast du dich entgeschleiert,
so tief, daß ich nach hinten prallte…
Der ganze Bauch war eine Falte!
Und das soll alles ich verlassen?
Berlin – ich kann es noch nicht fassen!
Du süße Stadt – ich komme wieder
und pfeif aufs neue deine Lieder.
Inzwischen, Liebste, laß mich gehn,
bleib hübsch gesund und laß mich stehn
die Lektrische, die Schutzmannschaft,
den Reichstag, die Germanenkraft,
die Kinos und die Landgerichte,
die Presse mit dem Weisheitslichte.
I Ich ab.
Und griene: „Daß dich Gott erhalte -!“
Der ganze Bauch ist eine Falte.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
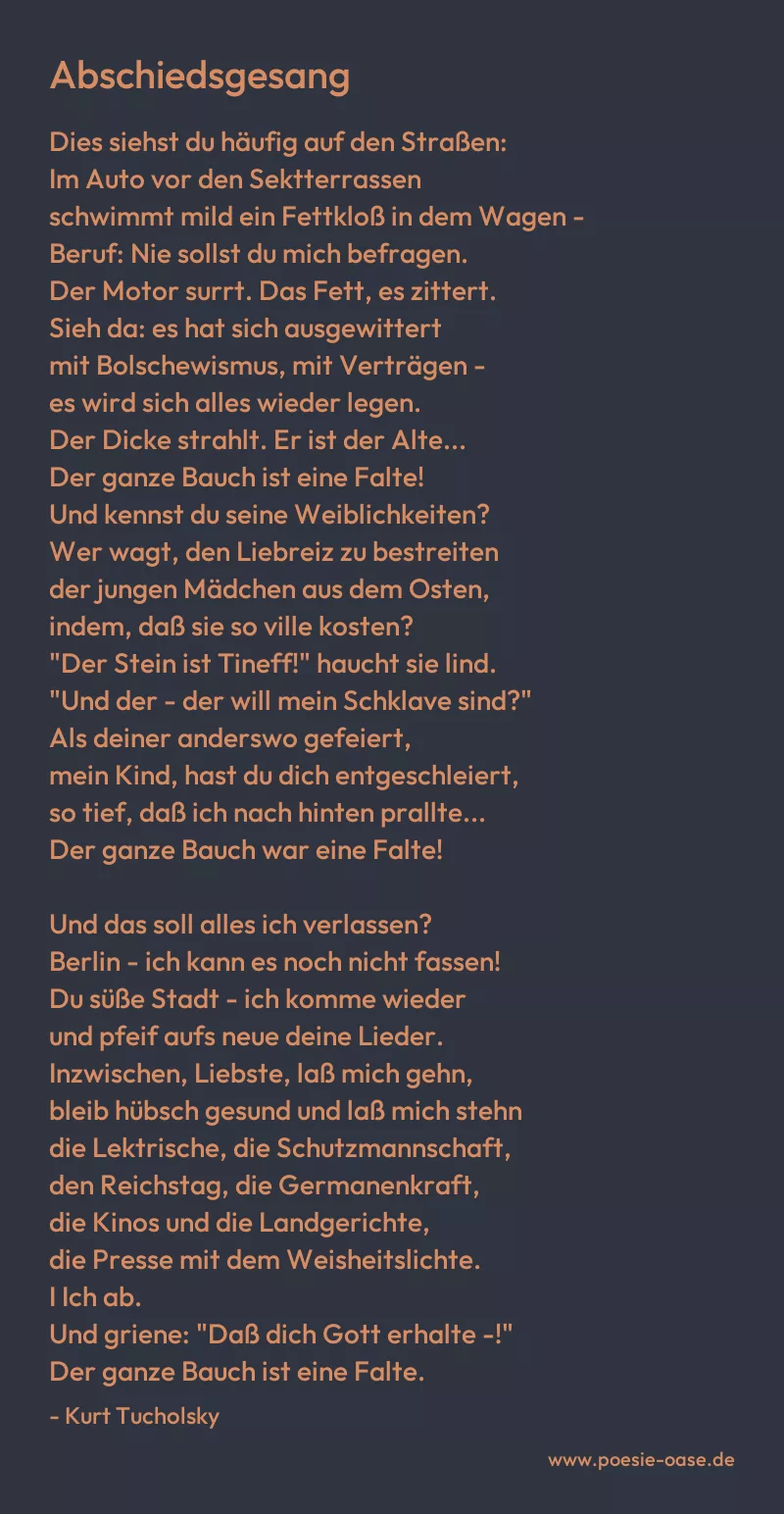
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abschiedsgesang“ von Kurt Tucholsky ist eine satirische Abrechnung mit den sozialen und politischen Zuständen im Berlin der Weimarer Republik, verpackt in einem scheinbaren Abschiedslied. Der Text persifliert die Dekadenz der wohlhabenden Schicht, die politischen Verwicklungen und die gesellschaftliche Doppelmoral, indem er einen ironischen Abschied vom Leben in Berlin inszeniert. Der „Dicke“, eine Karikatur des erfolgreichen Geschäftsmannes oder Politikers, fungiert hier als zentraler Protagonist und Repräsentant dieser verachtenswerten Welt. Seine äußere Erscheinung, insbesondere die „Falte“ am Bauch, wird zum wiederkehrenden Motiv, das seine Lebensweise und die Verachtung, die sie verdient, symbolisiert.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt das Leben des „Dicken“ mit seinen Vorlieben für Luxus, korrupte Geschäfte und die Ausbeutung junger Frauen aus dem Osten. Die Sprache ist zynisch und voller schwarzem Humor. Tucholsky verwendet eine Mischung aus Umgangssprache und gehobenen Ausdrücken, um die Hohlheit der Figuren und die Widersprüchlichkeit ihrer Welt zu unterstreichen. Die wiederholte Frage nach dem Beruf des Protagonisten und die abschlägige Antwort unterstreichen die Oberflächlichkeit und Beliebigkeit der Werte, die diese Gesellschaft prägen. Die Anspielungen auf politische Themen wie Bolschewismus und Verträge deuten auf die instabile politische Lage und die weit verbreitete Korruption hin.
Der zweite Teil des Gedichts markiert den Abschied von Berlin, der jedoch von einer eigentümlichen Ambivalenz geprägt ist. Der Protagonist versichert, dass er in die Stadt zurückkehren wird, und erwähnt dabei verschiedene Aspekte des Berliner Lebens, die er vermeintlich verlässt: die Elektrizität, die Polizei, den Reichstag, die Germanenkraft, Kinos, Gerichte und die Presse. Diese Aufzählung dient der Satire, indem sie die Absurdität und Widersprüchlichkeit der Stadt verdeutlicht. Der Abschied ist also nicht aufrichtig, sondern ein weiterer Ausdruck der Ironie und des Zynismus, der durch die Zeile „Daß dich Gott erhalte!“ und das abschließende, wiederholte „Der ganze Bauch ist eine Falte!“ noch verstärkt wird.
Tucholskys Gedicht ist ein hervorragendes Beispiel für seine satirische Meisterschaft. Durch die Kombination von Ironie, Sarkasmus und bissiger Kritik am gesellschaftlichen Zeitgeist gelingt es ihm, ein scharfes Bild der Dekadenz und des Verfalls in der Weimarer Republik zu zeichnen. Die Verwendung von Alltagssprache, der gekonnte Einsatz von Reimen und der wiederkehrende Refrain verleihen dem Gedicht einen hohen Wiedererkennungswert und machen es zu einem eindrucksvollen Zeugnis der politischen und gesellschaftlichen Zustände der Zeit. Die „Falte“ am Bauch des Dicken wird so zu einem Zeichen des Verfalls, das stellvertretend für die gesamte Gesellschaft steht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.