Es zogen Reiter in Schwadronen,
Fußsöldner, Schützen mit Kanonen
Der Straßen hin voll Lustgeschrei
An einem Narrenschalk vorbei.
„Was habt ihr doch?“ der Narre fragte,
„“Frischfröhlich Kriegen!““ jeder sagte;
„Was thut man denn im Krieg, ihr Leute?“
„“Man sticht, man schießt, gewinnet Beute,
Brennt Dörfer nieder; Korn und Wein
Mag freilich drob verdorben sein.““
„Und dies warum?“ „“Ei für den Frieden,
Der endet jeden Krieg hienieden!““
Da lacht der Narr: „Hier nehmt, ihr Leute
So Kapp′ wie Kolben gleich als Beute!
Macht vorher Frieden, eh′ zum Schaden
Der lust′ge Krieg dem Land geraten!
Wenn Glut geflossen, Glutenschein
Den Himmel rötet, Korn und Wein
Verdorben, und ihr selbst gestorben —
Heißt das nicht Narrending erworben?“
Der weise Narr
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
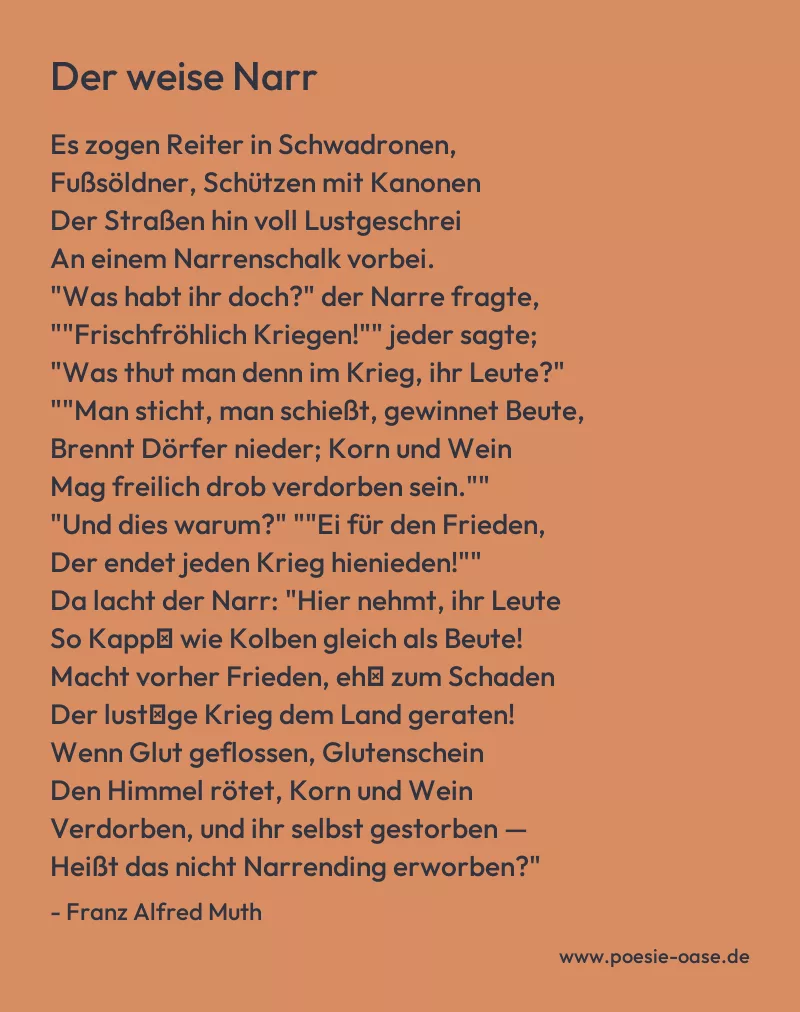
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der weise Narr“ von Franz Alfred Muth ist eine satirische Auseinandersetzung mit dem Krieg und seinen vermeintlichen Zielen. Es präsentiert die Absurdität des Krieges, indem es die kriegerischen Aktivitäten und ihre scheinbare Rechtfertigung durch den Frieden hinterfragt. Der Narr, als weiser Außenseiter, dient hier als Sprachrohr für die Kritik an der Kriegsbegeisterung und den daraus resultierenden Zerstörungen.
Die Struktur des Gedichts ist einfach und dialogisch gehalten. Die kriegführenden Soldaten werden zunächst als fröhliche Teilnehmer beschrieben, die voller „Lustgeschrei“ durch die Straßen ziehen. Der Narr, der die Situation aus einer distanzierten Position betrachtet, stellt Fragen, die die Soldaten dazu zwingen, ihr Handeln zu erklären. Die Antworten der Soldaten zeigen die Brutalität des Krieges – das Stechen, Schießen, Niederbrennen und Zerstören von Lebensgrundlagen wie Korn und Wein. Gleichzeitig wird die paradoxe Rechtfertigung des Krieges durch das Ziel des Friedens deutlich.
Der Clou des Gedichts liegt im Ausruf des Narren, der die Kriegstreiber selbst als Narren bezeichnet. Er bietet ihnen „Kapp′ wie Kolben gleich als Beute“ an, um sie zu verspotten. Die eigentliche Kritik wird in den letzten Strophen zusammengefasst, in denen der Narr die Folgen des Krieges aufzählt – das Verderben von Lebensgrundlagen, der Verlust von Menschenleben und die Zerstörung der Natur. Er stellt die rhetorische Frage, ob all dies nicht „Narrending erworben“ sei, und demaskiert so die vermeintliche Rationalität des Krieges.
Die Sprache des Gedichts ist einfach und direkt, was die Kritik an den Kriegstreibern umso deutlicher macht. Muth nutzt eine ironische Distanz, um die Absurdität des Krieges aufzuzeigen. Durch die Figur des Narren, der als weise Person agiert, wird die traditionelle Rolle des Narren als Unterhalter umgekehrt. Der Narr ist hier nicht nur ein Unterhalter, sondern ein Kritiker, der die etablierten Werte und Normen der Gesellschaft hinterfragt und die Widersprüche des Krieges entlarvt. Das Gedicht ist somit ein Plädoyer für den Frieden und eine Mahnung vor den verheerenden Folgen des Krieges.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
