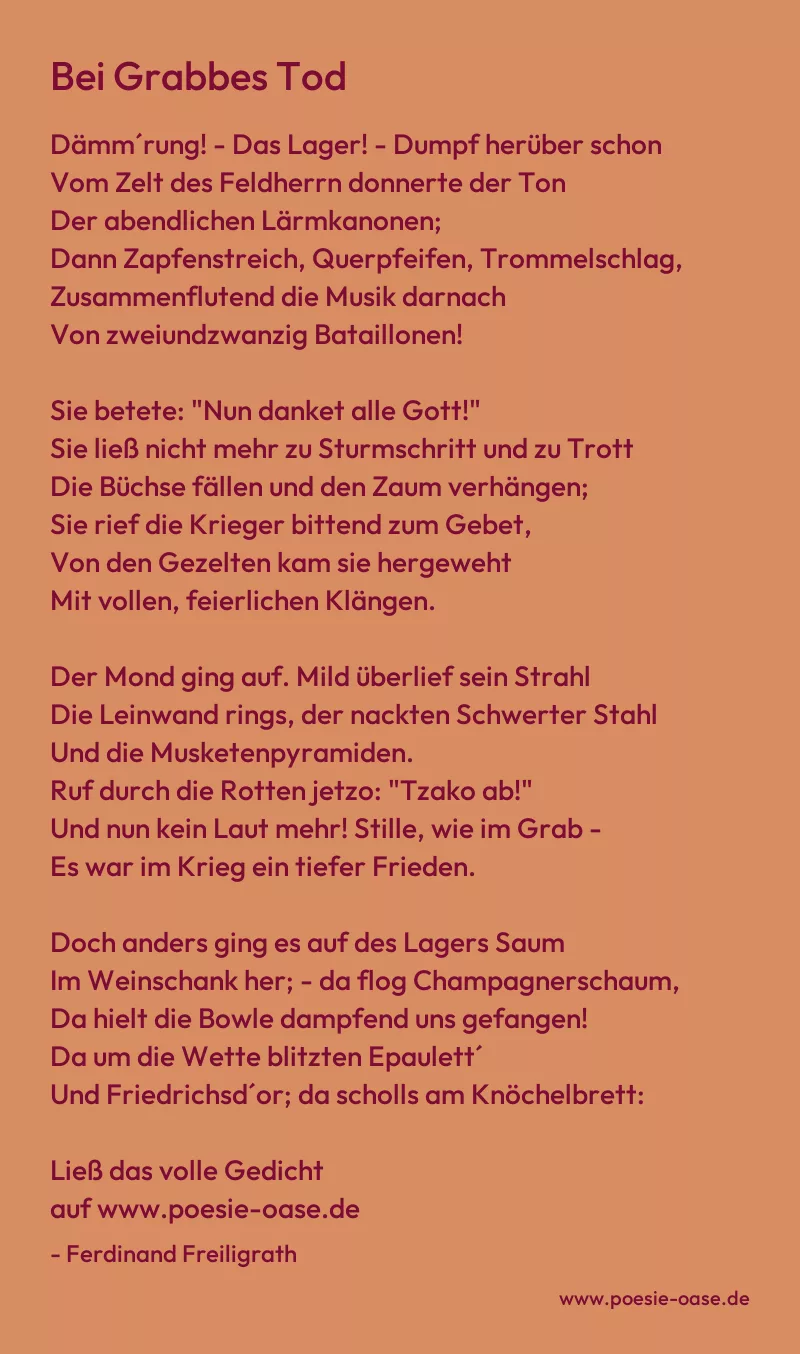Dämm´rung! – Das Lager! – Dumpf herüber schon
Vom Zelt des Feldherrn donnerte der Ton
Der abendlichen Lärmkanonen;
Dann Zapfenstreich, Querpfeifen, Trommelschlag,
Zusammenflutend die Musik darnach
Von zweiundzwanzig Bataillonen!
Sie betete: „Nun danket alle Gott!“
Sie ließ nicht mehr zu Sturmschritt und zu Trott
Die Büchse fällen und den Zaum verhängen;
Sie rief die Krieger bittend zum Gebet,
Von den Gezelten kam sie hergeweht
Mit vollen, feierlichen Klängen.
Der Mond ging auf. Mild überlief sein Strahl
Die Leinwand rings, der nackten Schwerter Stahl
Und die Musketenpyramiden.
Ruf durch die Rotten jetzo: „Tzako ab!“
Und nun kein Laut mehr! Stille, wie im Grab –
Es war im Krieg ein tiefer Frieden.
Doch anders ging es auf des Lagers Saum
Im Weinschank her; – da flog Champagnerschaum,
Da hielt die Bowle dampfend uns gefangen!
Da um die Wette blitzten Epaulett´
Und Friedrichsd´or; da scholls am Knöchelbrett:
„Wer hält?“ und Harfenmädchen sangen.
Zuweilen nur in dieses wüsten Saals
Getöse stahl ein Ton sich des Chorals,
Mischte der Mondschein sich dem Schein der Lichter.
Ich saß und sann – „Nun danket -“ >>Qui en veut?<<
Geklirr der Würfel – da auf einmal seh´
Aus meiner alten Heimath ich Gesichter.
„Was, du?“ – „“Wer sonst?““ – Nun Fragen hin und her.
„Wie geht´s? von wannen? was denn jetzt treibt der?“
Auf hundert Fragen mußt´ ich Antwort haben. –
„Wie -“ „“Nun, mach´ schnell! ich muß zu Schwarz und Roth!““
„Gleich! nur ein Wort noch: Grabbe?“ – „“Der ist todt;
Gut´ Nacht! wir haben Freitag ihn begraben!““
Es rieselte mir kalt durch Mark und Bein!
Sie senkten ihn vergangnen Freitag ein,
Mit Lorbeern und mit Immortellen
Den Sarg des todten Dichters schmückten sie –
Der du die hundert Tage schufst, so früh! –
Ich fühlte krampfhaft mir die Brust erschwellen.
Ich trat hinaus, ich gab der Nacht mein Haar;
Dann auf die Streu, die mir bereitet war
In einem Kriegerzelt, warf ich mich nieder.
Mein flatternd Obdach war der Winde Spiel;
Doch darum nicht floh meinen Halmenpfühl
Der Schlaf – nicht darum bebten meine Glieder.
Nein, um den Todten war´s, daß ich gewacht:
Ich sah´ ihn neben mir die ganze Nacht
Inmitten meiner Leinwandwände.
Erzitternd auf des Hohen prächt´ge Stirn
Legt´ ich die Hand: „Du loderndes Gehirn,
So sind jetzt Asche deine Brände?
Wachtfeuer sie, an deren sprüh´nder Glut
Der Hohenstaufen Heeresvolk geruht,
Des Corsen Volk und des Carthagers;
Jetzt mild wie Mondschein leuchtend durch die Nacht,
Und jetzo wild zu greller Brunst entfacht –
Den Lichtern ähnlich dieses Lagers!
So ist´s! wie Würfelklirren und Choral,
Wie Kerzenflackern und wie Mondenstrahl
Vorhin gekämpft um diese Hütten,
So wohl in dieses mächt´gen Schädels Raum,
Du jäh Verstummter, wie ein wüster Traum
Hat sich Befeindetes bestritten.
Sei´s! diesen Mantel werf´ ich drüber hin!
Du warst ein Dichter! – Kennt ihr auch den Sinn
Des Wortes, ihr, die kalt ihr richtet?
Dies Haus bewohnten Don Juan und Faust;
Der Geist, der unter dieser Stirn gehaus´t,
Zerbrach die Form – laßt ihn! er hat gedichtet!
Der Dichtung Flamm´ ist allezeit ein Fluch!
Wer, als ein Leuchter, durch die Welt sie trug,
Wohl läßt sie hehr den durch die Zeiten brennen;
Die Tausende, die unterm Leinen hier
In Waffen ruhn – was sind sie neben dir?
Wird ihrer Einen, so wie dich, man nennen?
Doch sie verzehrt; – ich sprech´ es aus mit Grau´n!
Ich habe dich gekannt als Jüngling; braun
Und kräftig gingst dem Knaben du vorüber.
Nach Jahren drauf erschaut´ ich dich als Mann;
Da warst du bleich, die hohe Stirne sann,
Und deine Schläfe pochten wie im Fieber.
Und Male brennt sie; – durch die Mitwelt geht
Einsam mit flammender Stirne der Poet;
Das Mal der Dichtung ist ein Kainsstempel!
Es flieht und richtet nüchtern ihn die Welt!“
Und ich entschlief zuletzt; in einem Zelt
Träumt´ ich von einem eingestürzten Tempel.