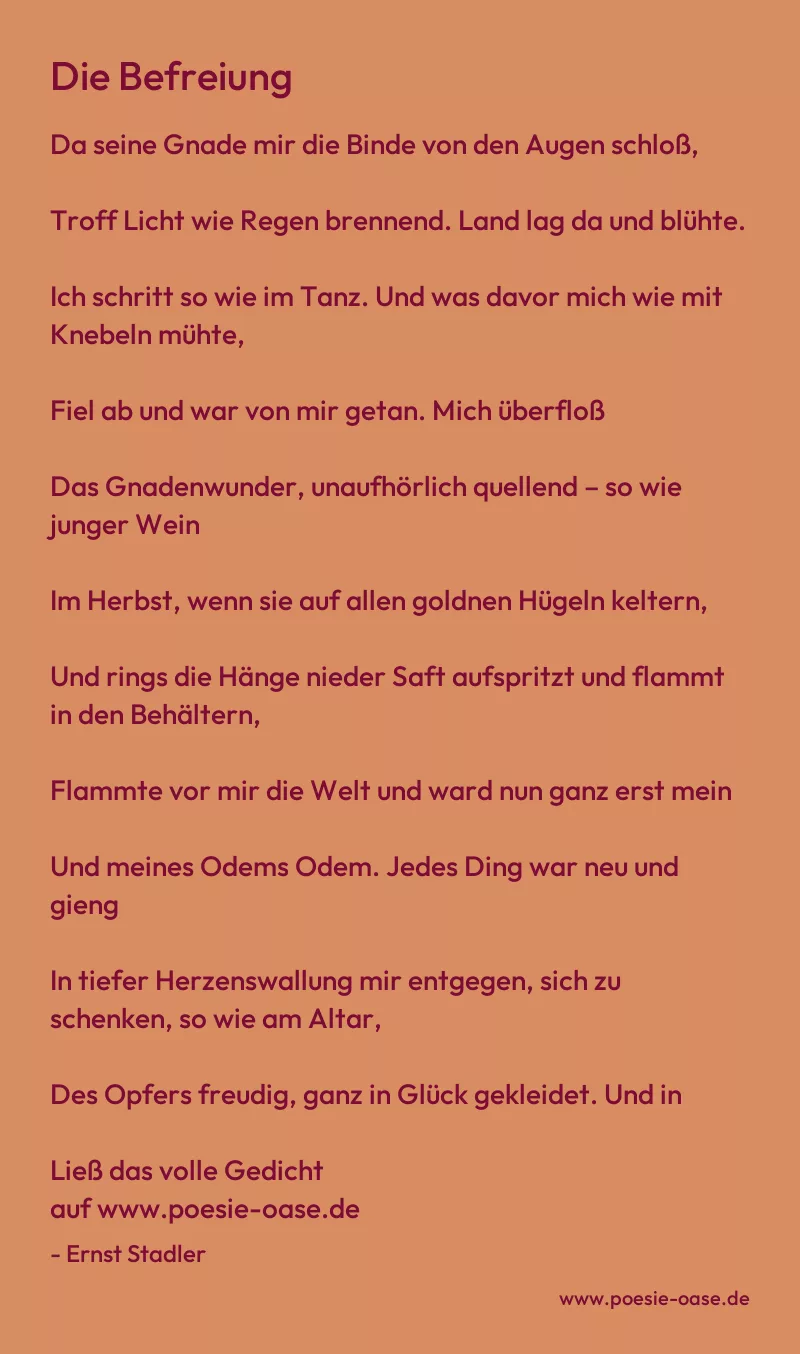Da seine Gnade mir die Binde von den Augen schloß,
Troff Licht wie Regen brennend. Land lag da und blühte.
Ich schritt so wie im Tanz. Und was davor mich wie mit Knebeln mühte,
Fiel ab und war von mir getan. Mich überfloß
Das Gnadenwunder, unaufhörlich quellend – so wie junger Wein
Im Herbst, wenn sie auf allen goldnen Hügeln keltern,
Und rings die Hänge nieder Saft aufspritzt und flammt in den Behältern,
Flammte vor mir die Welt und ward nun ganz erst mein
Und meines Odems Odem. Jedes Ding war neu und gieng
In tiefer Herzenswallung mir entgegen, sich zu schenken, so wie am Altar,
Des Opfers freudig, ganz in Glück gekleidet. Und in jedem war
Der Gott. Und keines war, darauf nicht seine Güte so wie Hauch um reife Früchte hieng.
Mir aber brach die Liebe alle Türen auf, die Hochmut mir gesperrt:
In Not Gescharte, Bettler, Säufer, Dirnen und Verbannte
Wurden mein lieb Geschwister. Meine Demut kniete vor dem Licht, das fern in ihren Augen brannte,
Und ihre rauhen Stimmen schlossen sich zum himmlischen Konzert.
Ich selbst war dunkel ihrem Leid und ihrer Lust vermengt – Welle im Chor
Auffahrender Choräle. Meine Seele war die kleine Glocke, die im Dorfkirchhimmel der Gebetehieng
Und selig läutend in dem Überschwang der Stimmen sich verlor
Und ausgeschüttet in dem Tausendfachen untergieng.