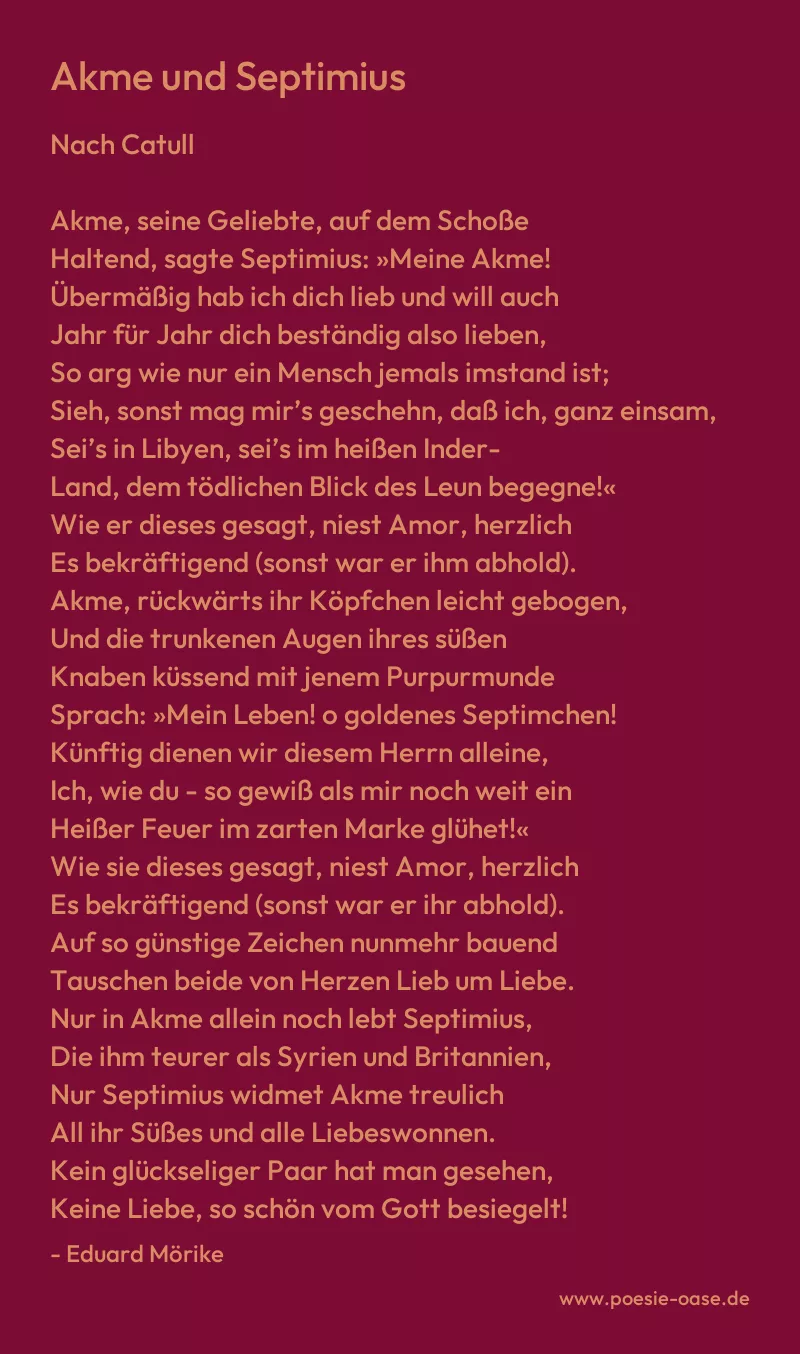Akme und Septimius
Nach Catull
Akme, seine Geliebte, auf dem Schoße
Haltend, sagte Septimius: »Meine Akme!
Übermäßig hab ich dich lieb und will auch
Jahr für Jahr dich beständig also lieben,
So arg wie nur ein Mensch jemals imstand ist;
Sieh, sonst mag mir’s geschehn, daß ich, ganz einsam,
Sei’s in Libyen, sei’s im heißen Inder-
Land, dem tödlichen Blick des Leun begegne!«
Wie er dieses gesagt, niest Amor, herzlich
Es bekräftigend (sonst war er ihm abhold).
Akme, rückwärts ihr Köpfchen leicht gebogen,
Und die trunkenen Augen ihres süßen
Knaben küssend mit jenem Purpurmunde
Sprach: »Mein Leben! o goldenes Septimchen!
Künftig dienen wir diesem Herrn alleine,
Ich, wie du – so gewiß als mir noch weit ein
Heißer Feuer im zarten Marke glühet!«
Wie sie dieses gesagt, niest Amor, herzlich
Es bekräftigend (sonst war er ihr abhold).
Auf so günstige Zeichen nunmehr bauend
Tauschen beide von Herzen Lieb um Liebe.
Nur in Akme allein noch lebt Septimius,
Die ihm teurer als Syrien und Britannien,
Nur Septimius widmet Akme treulich
All ihr Süßes und alle Liebeswonnen.
Kein glückseliger Paar hat man gesehen,
Keine Liebe, so schön vom Gott besiegelt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
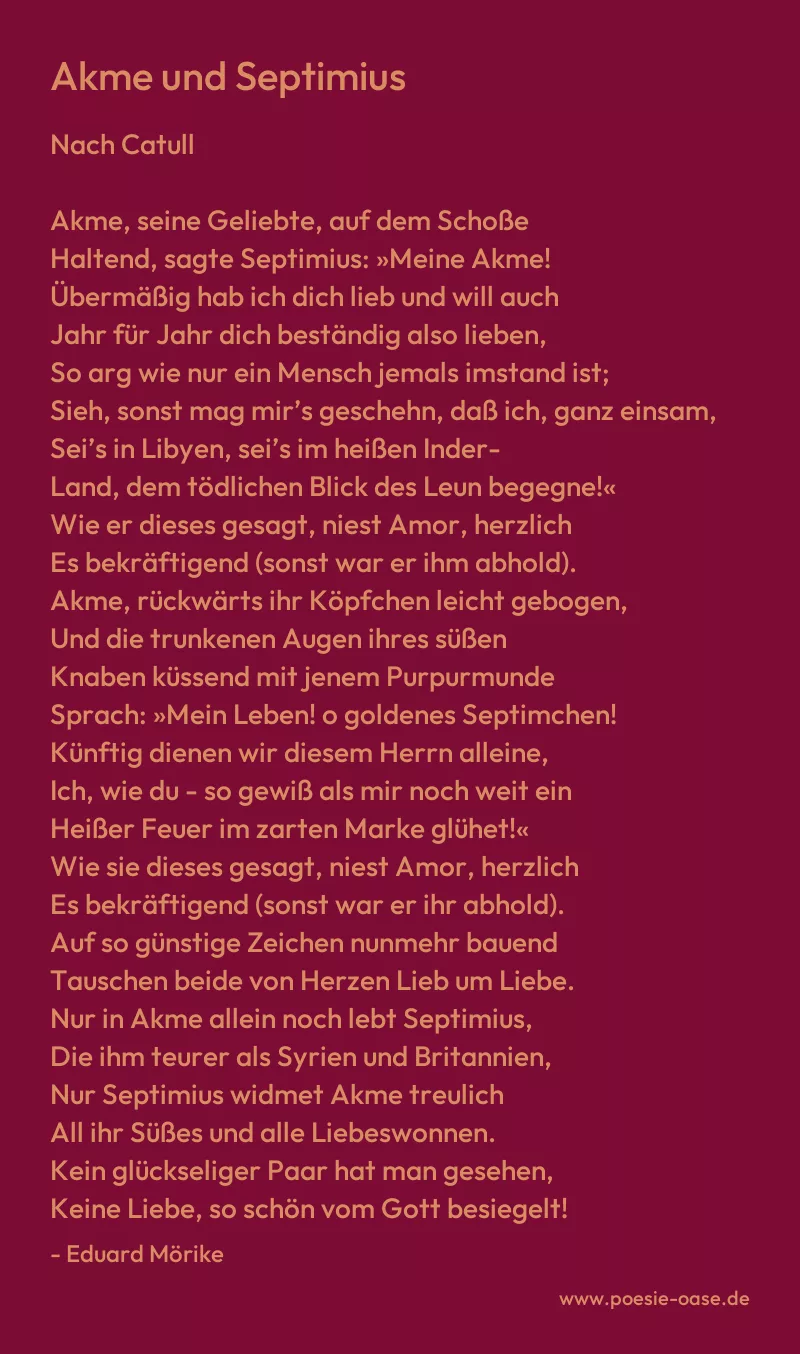
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Akme und Septimius“ von Eduard Mörike, inspiriert von Catull, ist eine charmante und zugleich melancholische Hommage an die Liebe und deren Vergänglichkeit. Es beschreibt die innige Zuneigung zwischen Akme und Septimius, die sich in ihren gegenseitigen Liebesschwüren und dem gemeinsamen Vertrauen auf die Bestätigung Amors, des Gottes der Liebe, manifestiert. Das Gedicht fängt die Intensität und die Hingabe ein, die oft mit der ersten großen Liebe einhergehen, und zeichnet ein Bild von Glück und Vertrautheit, das jedoch von einer subtilen Ahnung der Zukunft durchzogen ist.
Mörike verwendet eine elegante Sprache und eine klare Struktur, um die Szene zu beschreiben. Die Liebenden tauschen pathetische Liebesschwüre aus, die ihre tiefe Zuneigung unterstreichen. Die wiederholte Bestätigung Amors durch Niesen, als Zeichen seiner Zustimmung, verleiht der Szene eine spielerische Note und verstärkt den Eindruck, dass ihre Liebe vom Schicksal auserwählt ist. Die Verweise auf ferne Länder wie Libyen und Indien, in denen Septimius unglücklich sein würde, sowie die Metapher des „heißen Feuers“ im Herzen Akmes, unterstreichen die Exklusivität ihrer Liebe und ihre absolute Hingabe zueinander.
Trotz der Idylle und der beschworenen Ewigkeit der Liebe liegt eine stille Ahnung des Unvermeidlichen in der Luft. Die stete Betonung der gegenseitigen Verehrung und die fast krampfhafte Versicherung, dass ihre Liebe unsterblich sei, weisen auf eine unterschwellige Unsicherheit hin. Die Verliebten klammern sich an das Glück, was in diesem Moment real ist, und machen sich Illusionen, die der Realität des Lebens nicht standhalten werden. Der Leser spürt, dass das Glück, das sie so intensiv erleben, nicht ewig währen kann.
Die abschließenden Verse, die das glückselige Paar und die göttliche Besiegelung ihrer Liebe hervorheben, wirken fast wie ein Kontrapunkt zur ahnenden Melancholie. Sie sind ein Tribut an die Schönheit der Liebe und die Hoffnung auf ein erfülltes Leben, gleichzeitig aber auch eine Erinnerung an die Zerbrechlichkeit des Glücks. Mörike verwebt hier meisterhaft die Momente der Hingabe und Freude mit einer subtilen Melancholie, die dem Gedicht eine tiefere Bedeutung verleiht und den Leser dazu anregt, über die flüchtige Natur der Liebe und des Lebens nachzudenken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.