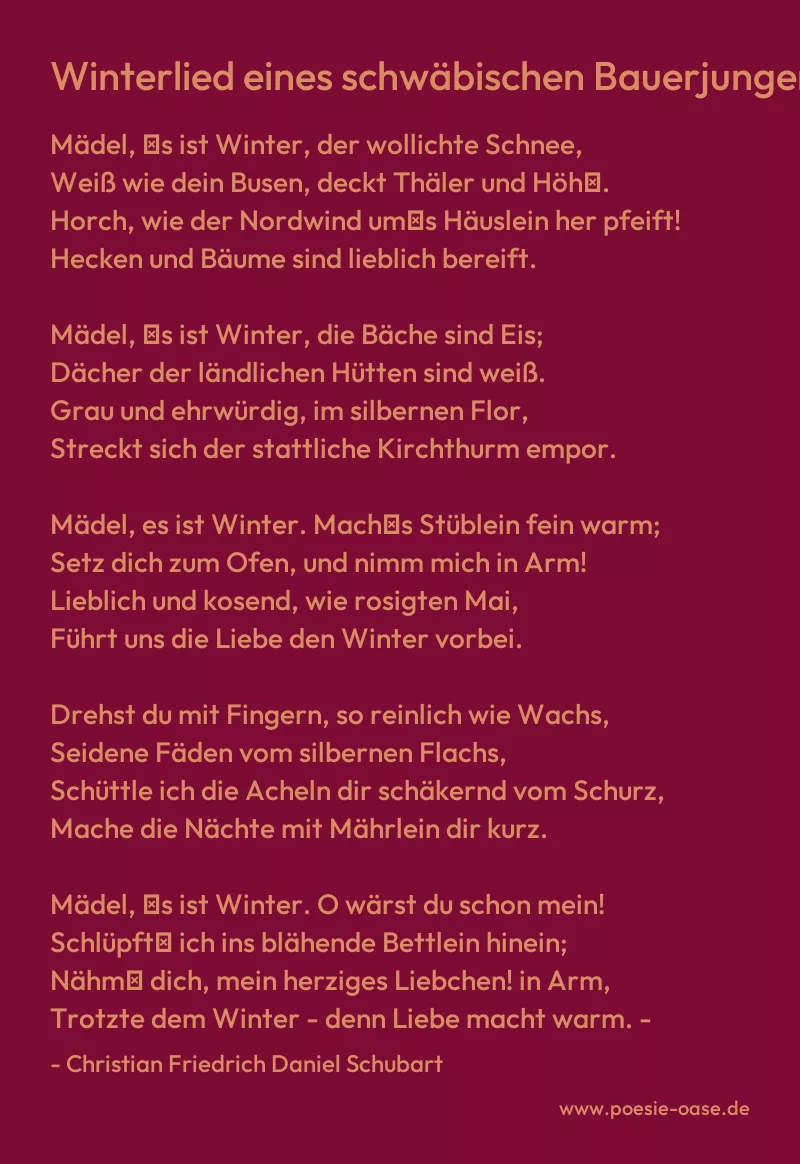Mädel, ′s ist Winter, der wollichte Schnee,
Weiß wie dein Busen, deckt Thäler und Höh′.
Horch, wie der Nordwind um′s Häuslein her pfeift!
Hecken und Bäume sind lieblich bereift.
Mädel, ′s ist Winter, die Bäche sind Eis;
Dächer der ländlichen Hütten sind weiß.
Grau und ehrwürdig, im silbernen Flor,
Streckt sich der stattliche Kirchthurm empor.
Mädel, es ist Winter. Mach′s Stüblein fein warm;
Setz dich zum Ofen, und nimm mich in Arm!
Lieblich und kosend, wie rosigten Mai,
Führt uns die Liebe den Winter vorbei.
Drehst du mit Fingern, so reinlich wie Wachs,
Seidene Fäden vom silbernen Flachs,
Schüttle ich die Acheln dir schäkernd vom Schurz,
Mache die Nächte mit Mährlein dir kurz.
Mädel, ′s ist Winter. O wärst du schon mein!
Schlüpft′ ich ins blähende Bettlein hinein;
Nähm′ dich, mein herziges Liebchen! in Arm,
Trotzte dem Winter – denn Liebe macht warm. –