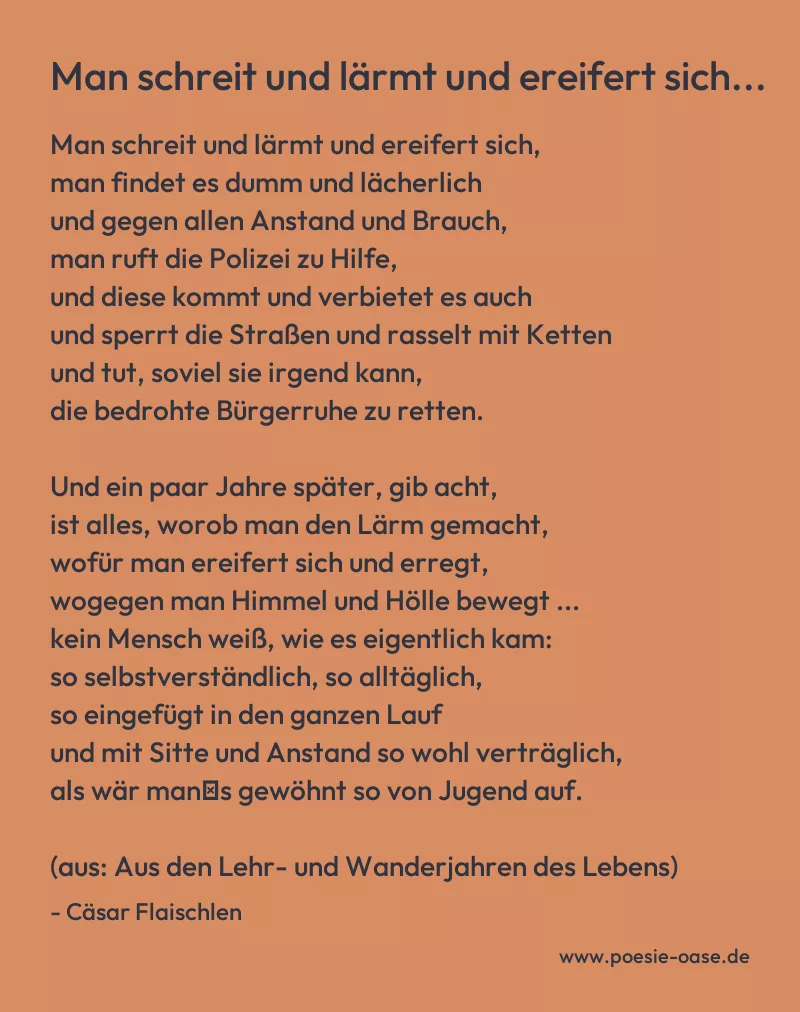Man schreit und lärmt und ereifert sich…
Man schreit und lärmt und ereifert sich,
man findet es dumm und lächerlich
und gegen allen Anstand und Brauch,
man ruft die Polizei zu Hilfe,
und diese kommt und verbietet es auch
und sperrt die Straßen und rasselt mit Ketten
und tut, soviel sie irgend kann,
die bedrohte Bürgerruhe zu retten.
Und ein paar Jahre später, gib acht,
ist alles, worob man den Lärm gemacht,
wofür man ereifert sich und erregt,
wogegen man Himmel und Hölle bewegt …
kein Mensch weiß, wie es eigentlich kam:
so selbstverständlich, so alltäglich,
so eingefügt in den ganzen Lauf
und mit Sitte und Anstand so wohl verträglich,
als wär man′s gewöhnt so von Jugend auf.
(aus: Aus den Lehr- und Wanderjahren des Lebens)
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
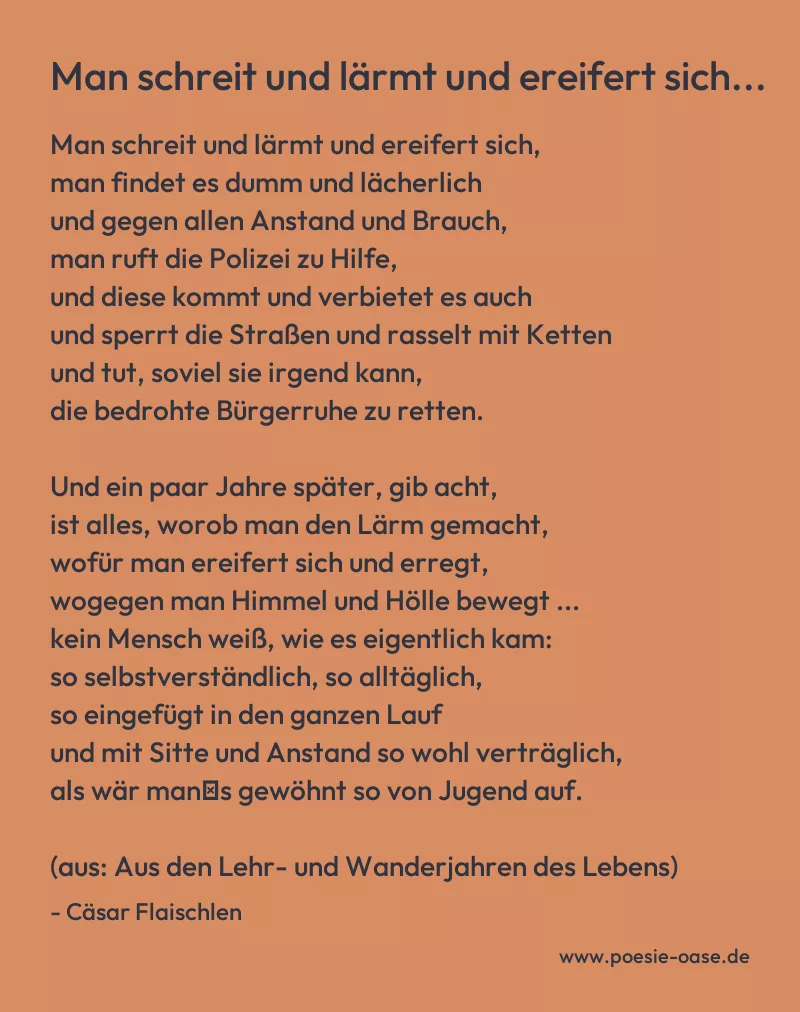
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Man schreit und lärmt und ereifert sich…“ von Cäsar Flaischlen thematisiert die Vergänglichkeit menschlicher Aufregung und Empörung angesichts von Veränderungen. Es beginnt mit der Beschreibung einer hitzigen Reaktion auf etwas, das als „dumm“ und „lächerlich“ empfunden wird. Die Menschen schreien, lärmen, ereifern sich, ziehen die Polizei hinzu, die ihrerseits eingreift und versucht, die „bedrohte Bürgerruhe zu retten“. Dies deutet auf eine konservative Abwehrhaltung gegen eine neue Entwicklung oder Idee hin, die das etablierte gesellschaftliche Gefüge zu stören scheint.
Der zweite Teil des Gedichts offenbart die Ironie dieser heftigen Reaktionen. Nach nur wenigen Jahren hat sich das, worüber sich die Menschen so aufgeregt haben, in den Alltag integriert. Das, was zunächst als Aufruhr und Bedrohung wahrgenommen wurde, ist nun „selbstverständlich“, „alltäglich“, „mit Sitte und Anstand so wohl verträglich“, als hätte es schon immer dazugehört. Die anfängliche Empörung erscheint rückblickend als übertrieben und sinnlos. Der Autor hebt die erstaunliche Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft hervor, die dazu führt, dass selbst die größten Kontroversen mit der Zeit an Bedeutung verlieren.
Flaischlen nutzt eine einfache, klare Sprache, um seine Botschaft zu vermitteln. Die Wiederholung von „man“ unterstreicht die allgemeine Gültigkeit seiner Beobachtung, die sich auf die menschliche Natur bezieht. Die Verwendung von Reimen (z.B. „brauch“ – „auch“) und einem relativ einfachen Metrum trägt dazu bei, die Leser anzusprechen und ihnen die Botschaft zugänglich zu machen. Der Übergang vom aktiven Widerstand zur späteren Akzeptanz wird durch einen sanften Rhythmuswechsel und eine ironische Distanzierung des Erzählers betont.
Die Kernaussage des Gedichts ist eine Mahnung zur Gelassenheit und Relativierung des eigenen Urteils. Es fordert den Leser auf, die kurzfristige Perspektive zu verlassen und die langfristige Entwicklung zu berücksichtigen. Die Reaktion auf vermeintliche Bedrohungen und Veränderungen sollte nicht vorschnell und hysterisch sein, sondern mit Ruhe und einem gewissen Humor betrachtet werden. Das Gedicht ist eine zeitlose Reflexion über die Dynamik von Wandel und Gewöhnung. Es wirft die Frage auf, wie wir mit Dingen umgehen, die uns zunächst fremd erscheinen, und erinnert uns daran, dass vieles, was uns heute aufregt, morgen schon wieder vergessen sein könnte.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.