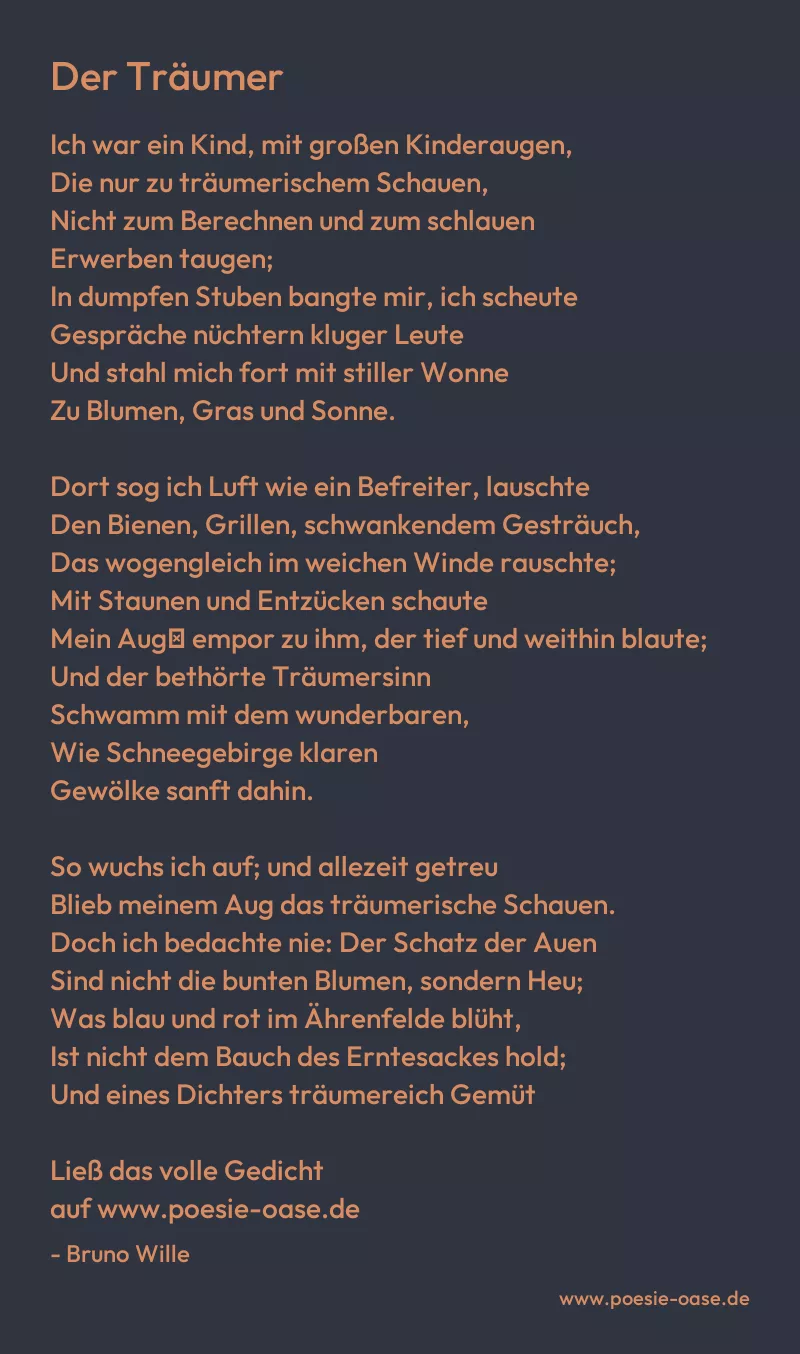Emotionen & Gefühle, Entdeckungen, Flüsse & Meere, Freiheit & Sehnsucht, Frühling, Götter, Herbst, Himmel & Wolken, Jahreszeiten, Liebe & Romantik, Natur, Russland, Sommer, Winter
Der Träumer
Ich war ein Kind, mit großen Kinderaugen,
Die nur zu träumerischem Schauen,
Nicht zum Berechnen und zum schlauen
Erwerben taugen;
In dumpfen Stuben bangte mir, ich scheute
Gespräche nüchtern kluger Leute
Und stahl mich fort mit stiller Wonne
Zu Blumen, Gras und Sonne.
Dort sog ich Luft wie ein Befreiter, lauschte
Den Bienen, Grillen, schwankendem Gesträuch,
Das wogengleich im weichen Winde rauschte;
Mit Staunen und Entzücken schaute
Mein Aug′ empor zu ihm, der tief und weithin blaute;
Und der bethörte Träumersinn
Schwamm mit dem wunderbaren,
Wie Schneegebirge klaren
Gewölke sanft dahin.
So wuchs ich auf; und allezeit getreu
Blieb meinem Aug das träumerische Schauen.
Doch ich bedachte nie: Der Schatz der Auen
Sind nicht die bunten Blumen, sondern Heu;
Was blau und rot im Ährenfelde blüht,
Ist nicht dem Bauch des Erntesackes hold;
Und eines Dichters träumereich Gemüt
Trägt wenig Körnchen irdisch Gold. –
Nun stehn die Äcker braun und stopplig nackt,
Geschorne Wiesen werden bleich und bleicher,
Und mir zum Spotte tanzt im fremden Speicher
Der plumpe Flegel trocknen Erntetakt.
Am Dornstrauch sitz′ ich, trübe wie der Himmel;
Verwelkte Blätter zerrt ein rauher Wind,
Scheucht mürrisch fort das raschelnde Gewimmel;
Und träumend starr′ ich nach … ich dummes großes Kind!
Der Winter kommt; ich werde frieren, darben
Und wie die arme Maus im Stoppelwald
Mich nähren von dem Abfall fremder Garben;
Vielleicht auch sterb′ ich bald …
Mag sein! Doch schließ′ ich ohne Reue
Und segne dankbar meinen Träumerblick;
Er ließ mich lieben Flur und Himmelsbläue,
Und diese Liebe war mein Lebensglück.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
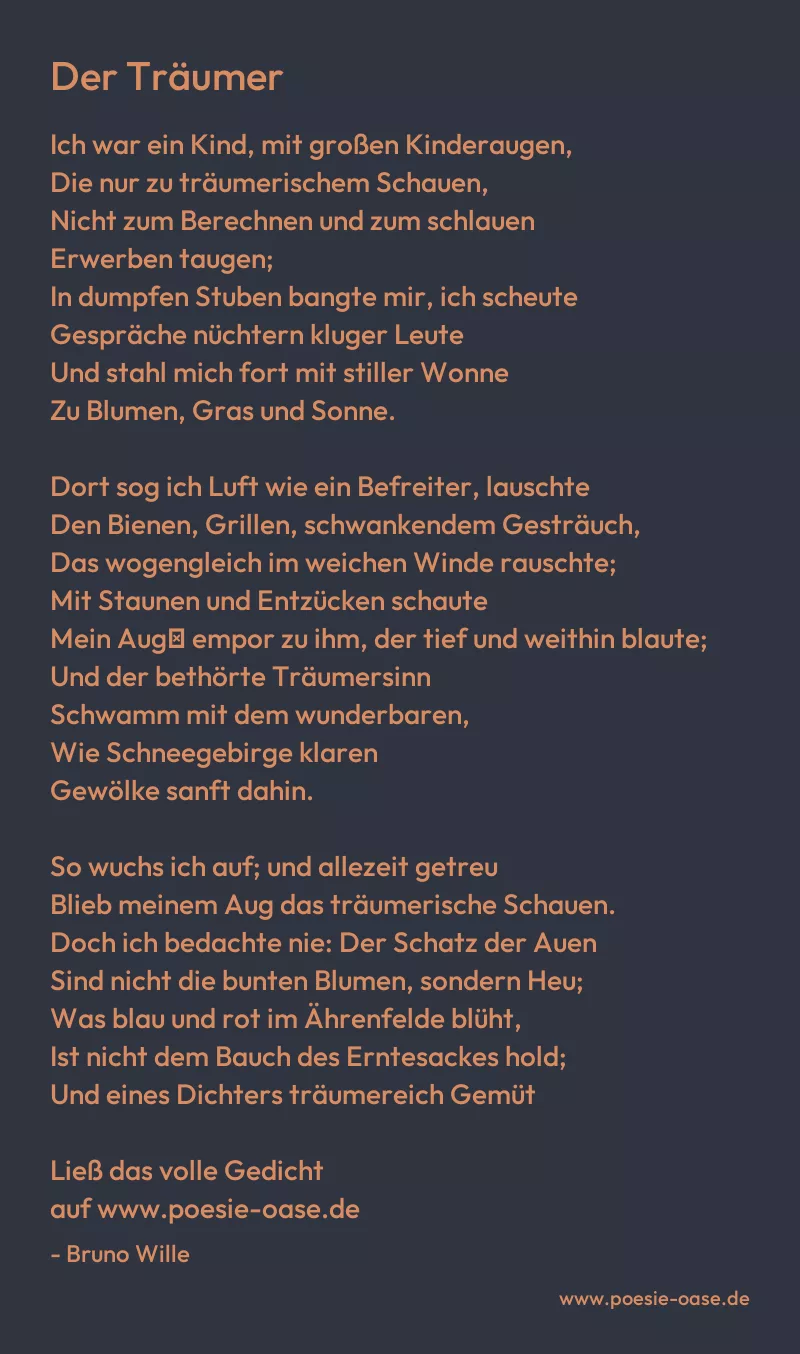
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Träumer“ von Bruno Wille ist eine melancholische Selbstreflexion über die Kindheit, das Träumen und die Kluft zwischen idealistischer Sehnsucht und der harten Realität des Lebens. Es erzählt die Geschichte eines Kindes, das sich von der Welt des Traumes, der Natur und der Schönheit angezogen fühlte, und die Erkenntnis, dass diese Welt dem Erwachsenenleben nicht entspricht.
In den ersten beiden Strophen wird die Kindheit des lyrischen Ichs beschrieben. Die „großen Kinderaugen“, die „nur zu träumerischem Schauen“ taugen, symbolisieren die Unschuld und die Unfähigkeit, sich den pragmatischen Anforderungen der Welt zu stellen. Das Kind flieht vor „nüchtern kluger Leute“ und findet Trost in der Natur – „Blumen, Gras und Sonne“. Hier wird eine idyllische Welt beschworen, in der der Träumer in Harmonie mit den „Bienen, Grillen“ und dem „weichen Winde“ lebt. Diese Abschnitte stehen für die reine Freude und das Staunen, das das Kind in der Natur findet. Der „wunderbare“ Himmel und die „sanft dahin“ schwimmenden Gewölke verkörpern die grenzenlose Fantasie und die Fähigkeit zum Träumen.
Die dritte und vierte Strophe markieren den Übergang zur Ernüchterung. Die Erkenntnis, dass die Schönheit der Natur nicht mit den praktischen Bedürfnissen des Lebens – wie „irdisch Gold“ und „Heu“ – vereinbar ist, deutet auf den Verlust der kindlichen Unschuld hin. Das lyrische Ich wird mit der Realität konfrontiert, in der der „plumpe Flegel“ den Erntetakt vorgibt, während es selbst zum „Spotte“ wird. Die Beschreibung der „braun und stopplig nackt“ gewordenen Äcker und der „verwelkten Blätter“ symbolisiert den Verfall der kindlichen Idylle und das Herannahen des Winters. Das lyrische Ich wird zum Außenseiter, der am „Dornstrauch“ sitzt, von einem „rauhen Wind“ verscheucht, und der Einsamkeit und dem Verlust der einstigen Freude ausgesetzt ist.
Die letzte Strophe ist eine bittersüße Bilanz. Das lyrische Ich antizipiert den Winter, das „Frieren“ und „Darben“, bis hin zum möglichen Tod. Es wird die „arme Maus“ in einem Leben am Rande der Gesellschaft. Trotz all dieser Härten, schließt es mit einer Versöhnung. Es bereut nicht seinen Traum und segnet seinen „Träumerblick“. Die Liebe zur Natur und die Fähigkeit, die Schönheit der Welt wahrzunehmen, werden als das wahre „Lebensglück“ gefeiert. Das Gedicht endet also mit einem paradoxen Gefühl der Akzeptanz und der Wertschätzung des Traumes, auch wenn dieser nicht mit den Erwartungen der realen Welt übereinstimmt. Es ist eine Hommage an die Kraft der Fantasie und die Schönheit der Welt, selbst angesichts des Leids.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.