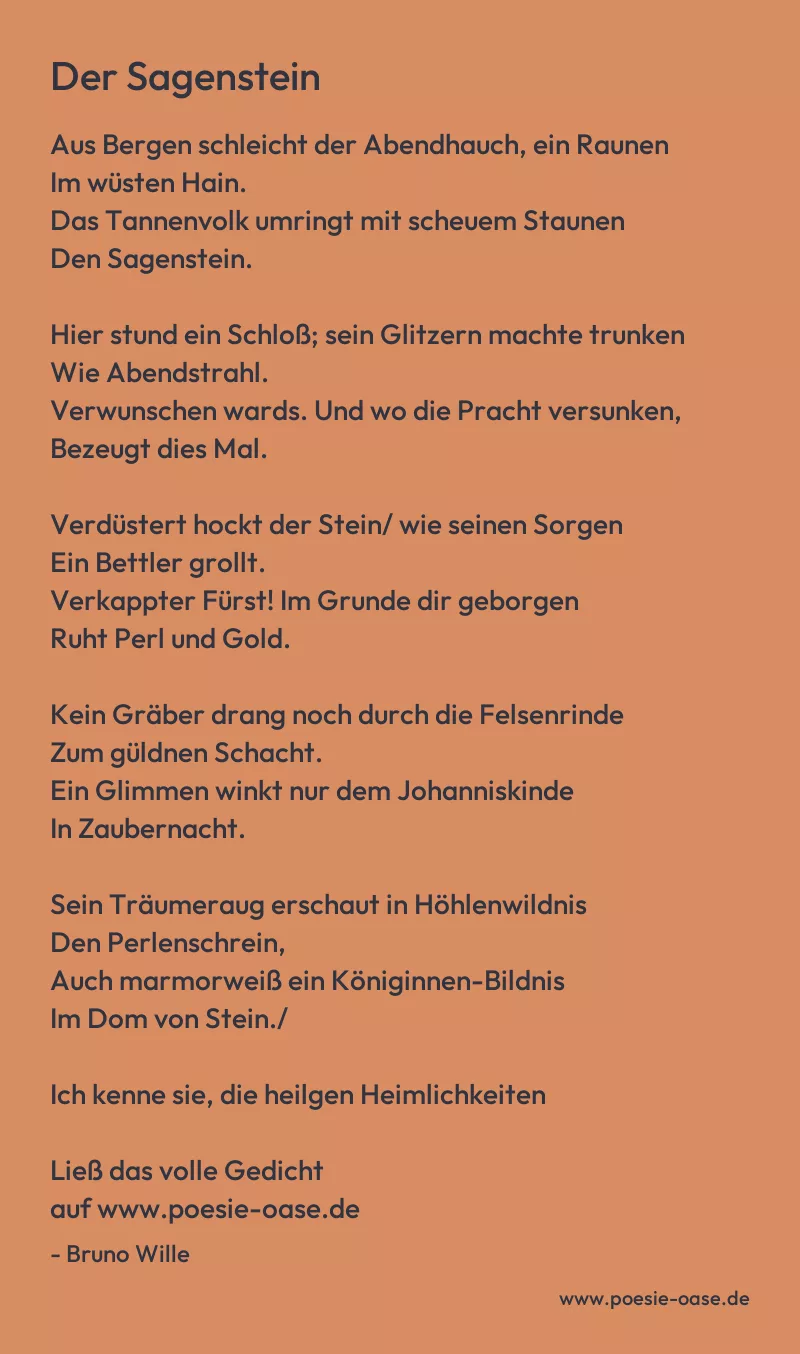Der Sagenstein
Aus Bergen schleicht der Abendhauch, ein Raunen
Im wüsten Hain.
Das Tannenvolk umringt mit scheuem Staunen
Den Sagenstein.
Hier stund ein Schloß; sein Glitzern machte trunken
Wie Abendstrahl.
Verwunschen wards. Und wo die Pracht versunken,
Bezeugt dies Mal.
Verdüstert hockt der Stein/ wie seinen Sorgen
Ein Bettler grollt.
Verkappter Fürst! Im Grunde dir geborgen
Ruht Perl und Gold.
Kein Gräber drang noch durch die Felsenrinde
Zum güldnen Schacht.
Ein Glimmen winkt nur dem Johanniskinde
In Zaubernacht.
Sein Träumeraug erschaut in Höhlenwildnis
Den Perlenschrein,
Auch marmorweiß ein Königinnen-Bildnis
Im Dom von Stein./
Ich kenne sie, die heilgen Heimlichkeiten
Der Innenschau.
Verwunschen sank auch mir ins Grab der Zeiten
Mein Königsbau.
Doch was dereinst an Seligkeit erblühte,
Ist nimmer tot;
Es bleibt mein Schatz, versunken im Gemüte,
Der magisch loht.
Ich selber bin das Schloß mit güldner Tiefe,
Der Sagenstein.
Und ob ich ganz der Oberwelt entschliefe,
Der Traum ist mein.
Die Königin ward diesen heißen Sinnen
Hinweggebannt.
Verklärt zum Engel weiht sie nun mein Minnen
Dem Geisterland.
Als Dom von Tropfgestein soll mich umflechten
Die Innenwelt.
Braut meiner Jugend, throne mir zur Rechten
Im Höhlenzelt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
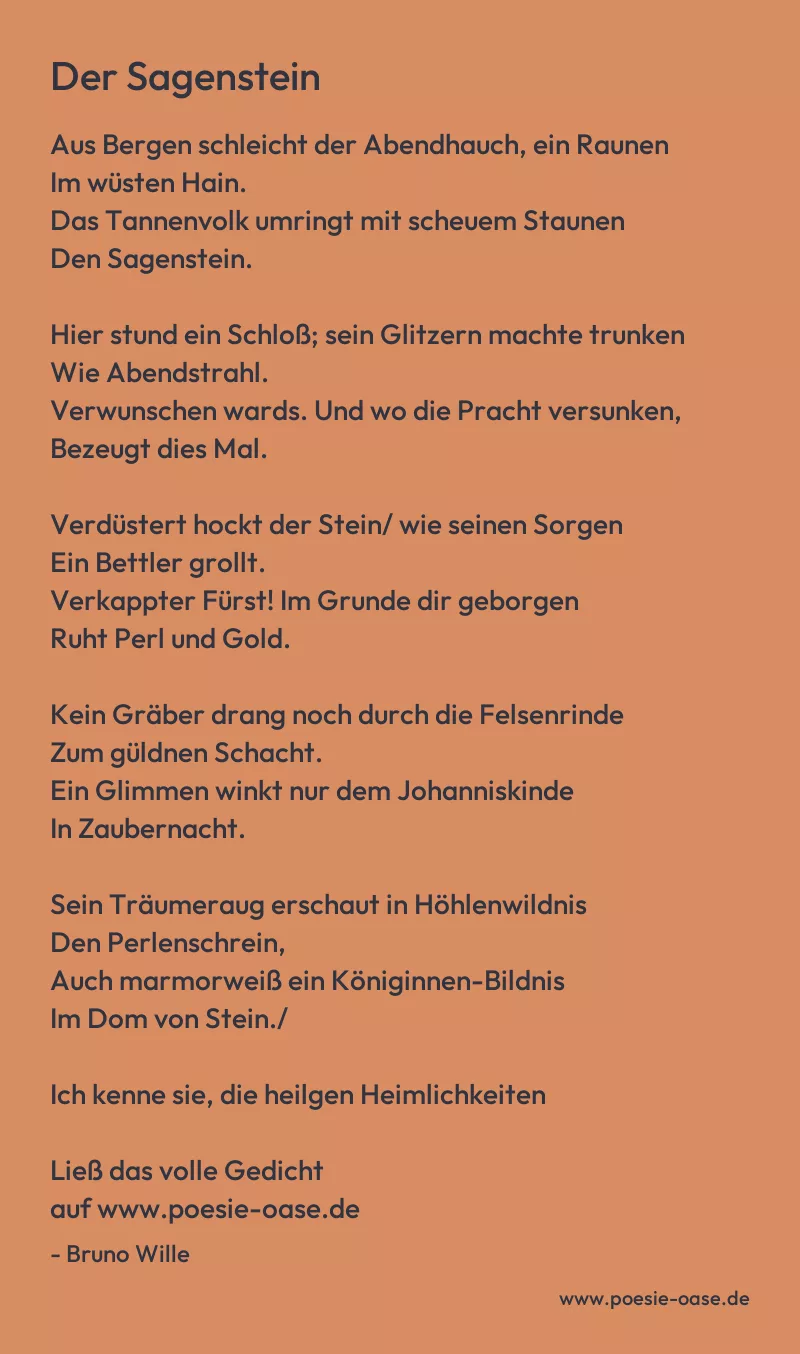
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sagenstein“ von Bruno Wille ist eine tiefgründige Reflexion über Verlust, Erinnerung und die transformative Kraft der inneren Welt. Es beginnt mit einer atmosphärischen Beschreibung des abendlichen Waldes und der mystischen Aura, die den Sagenstein umgibt. Dieser Stein symbolisiert eine vergangene Pracht, ein versunkenes Schloss, das durch Verzauberung verschwunden ist. Der Dichter stellt eine Verbindung zwischen der äußeren Welt des Steins und der inneren Welt des Menschen her, wobei der Stein als Analogie für die eigene innere Landschaft dient.
Die zentrale Metapher des Gedichts ist die Identifizierung des lyrischen Ichs mit dem Sagenstein. Der Stein, einst Zeuge von Prunk und Reichtum, ist nun verdunkelt und trägt die Last der Sorgen, ähnlich wie ein Bettler. In seinem Inneren birgt er jedoch verborgene Schätze, Perlen und Gold, die im Verborgenen ruhen. Diese verborgenen Schätze repräsentieren Erinnerungen, Träume und die unsterblichen Aspekte der Vergangenheit, die im Inneren des Menschen weiterleben. Die „Innenschau“, die Kenntnis der „heilgen Heimlichkeiten“, ist hier von zentraler Bedeutung, da sie den Zugang zu diesen verborgenen Schätzen ermöglicht.
Das Gedicht drückt eine tiefe Melancholie aus, die mit dem Verlust der äußeren Pracht einhergeht, aber gleichzeitig einen Trost in der inneren Welt findet. Das lyrische Ich, wie der Stein, hat sein „Königsbau“ – die Vergangenheit, Träume und Lieben – verloren. Doch diese Vergangenheit ist nicht völlig verloren, sondern versinkt im „Gemüte“ und leuchtet dort „magisch“. Die „Königin“, eine Metapher für die geliebte Person oder die Ideale der Jugend, wird in eine spirituelle Sphäre, das „Geisterland“, erhoben. Die Innenwelt wird zum „Dom von Tropfgestein“, in dem die geliebte Person, nun als „Braut meiner Jugend“, im Herzen des Dichters weiterlebt.
Das Gedicht gipfelt in der Erkenntnis, dass das lyrische Ich selbst der Sagenstein ist. Durch die Identifizierung mit dem Stein, der das versunkene Schloss birgt, wird die transformative Kraft des Traumes und der Erinnerung betont. Obwohl die äußere Welt verschwinden mag, bleibt die innere Welt bestehen, in der die Träume, Erinnerungen und die Liebe weiterleben. Die „Oberwelt“ mag entschwinden, aber der „Traum ist mein“. Dieses Gedicht ist eine Feier der inneren Welt und der Fähigkeit des Menschen, durch Erinnerung und Vorstellungskraft eine neue, ewige Realität zu erschaffen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.