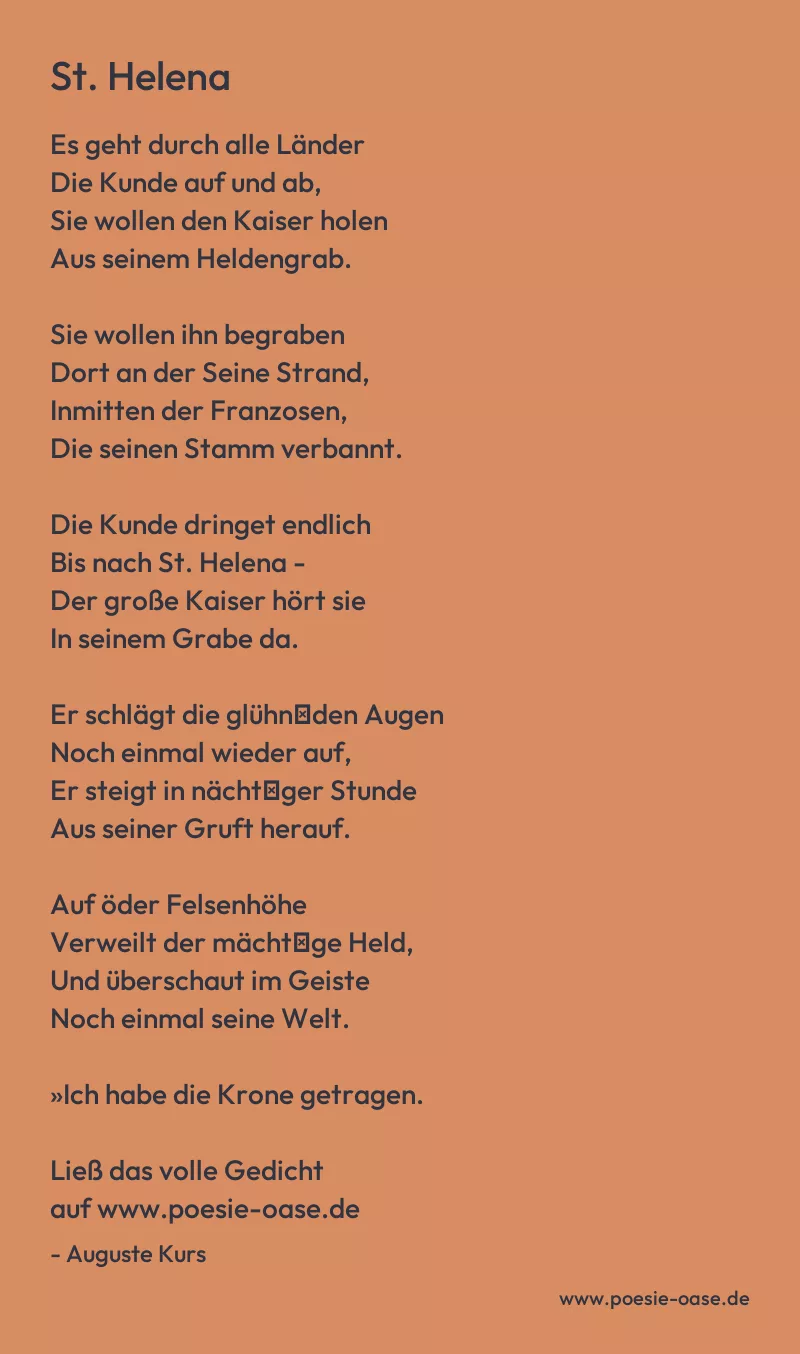Es geht durch alle Länder
Die Kunde auf und ab,
Sie wollen den Kaiser holen
Aus seinem Heldengrab.
Sie wollen ihn begraben
Dort an der Seine Strand,
Inmitten der Franzosen,
Die seinen Stamm verbannt.
Die Kunde dringet endlich
Bis nach St. Helena –
Der große Kaiser hört sie
In seinem Grabe da.
Er schlägt die glühn′den Augen
Noch einmal wieder auf,
Er steigt in nächt′ger Stunde
Aus seiner Gruft herauf.
Auf öder Felsenhöhe
Verweilt der mächt′ge Held,
Und überschaut im Geiste
Noch einmal seine Welt.
»Ich habe die Krone getragen.
Die goldene Kaiserkron′,
Ich blickte auf Millionen
Hinab vom höchsten Thron.
Von Königen war gebildet
Der Hof, der mich umgab,
Ich hab′ über zahllose Heere
Geschwungen den Feldherrnstab.
Sie hatten es geschworen
Im hellen Sonnenlicht,
Die Garde kann wohl sterben,
Doch sie ergiebt sich nicht.
Sie haben mich verlassen
In meiner höchsten Noth,
Sie sind ihn nicht gestorben
Den schönen Schlachtentod.
Nun wollen sie mich führen
Inmitten ihrer Welt,
Sie, die mich ausgestoßen,
Die mir kein Band mehr hält.
In dumpfen Mausoleen
Da weht nicht meine Luft,
Was denkt ihr mich zu schließen
In enger Mauern Gruft?
Des großen Weltmeers Wogen
Umfluthen jetzt mein Grab,
Sie brausen mir und rauschen
Mein Schlummerlied hinab.
Ich ruh′, ein müder Krieger,
Nun unterm Sternenzelt,
Allein, wie ich gestanden,
Als mir zu klein die Welt.
Mein Geist umschweift die Stätten,
Wo ich die Schlachten schlug,
Hier weilt er auf dem Felsen,
Wo ich das Schwerste trug.
Die Asche mögt ihr hüten,
Der Geist ist euch nicht nah,
Und wer mich nennt, gedenken
Wird er St. Helena.