Vor meinem Fenster
singt ein Vogel.
Still hör ich zu; mein Herz vergeht.
Er singt,
was ich als Kind besass,
und dann – vergessen.
Vor meinem Fenster
singt ein Vogel.
Still hör ich zu; mein Herz vergeht.
Er singt,
was ich als Kind besass,
und dann – vergessen.
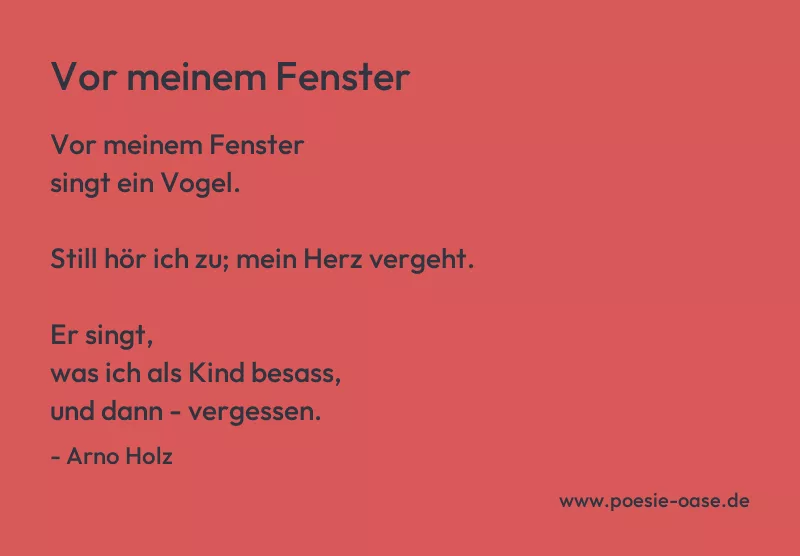
Das Gedicht „Vor meinem Fenster“ von Arno Holz ist eine kurze, aber eindringliche Reflexion über die Flüchtigkeit der Kindheit und das Vergessen, das mit dem Erwachsenwerden einhergeht. Es ist ein Moment der Kontemplation, ausgelöst durch den Gesang eines Vogels, der eine tiefe Sehnsucht und Melancholie in dem lyrischen Ich auslöst. Das Gedicht ist in einer schlichten Sprache verfasst, die durch ihre Einfachheit eine besondere Intensität entfaltet.
Die ersten beiden Zeilen etablieren die Szene: „Vor meinem Fenster / singt ein Vogel.“ Diese banale Feststellung etabliert die äußere Umgebung, die als Auslöser für die nachfolgenden Emotionen dient. Der Vogelgesang, ein Zeichen von Unbeschwertheit und Naturverbundenheit, steht in starkem Kontrast zu dem Gefühl der Melancholie, das das lyrische Ich empfindet. Der Übergang zur zweiten Strophe, „Still hör ich zu; mein Herz vergeht,“ verdeutlicht die emotionale Wirkung des Gesangs. Das stille Zuhören wird zu einer passiven Hingabe an die Emotionen, die durch den Vogel hervorgerufen werden. Das „Vergehen des Herzens“ deutet auf ein tiefes Gefühl von Trauer, Verlust und der Vergänglichkeit der eigenen Gefühle hin.
Der Kern des Gedichts liegt in den beiden abschließenden Versen: „Er singt, / was ich als Kind besass, / und dann – vergessen.“ Hier wird die Verbindung zwischen dem Vogelgesang und der verlorenen Kindheit hergestellt. Der Gesang wird als Erinnerung an etwas interpretiert, das einst dem lyrischen Ich gehörte – wahrscheinlich Freude, Unbeschwertheit, Träume oder die Fähigkeit, die Welt mit kindlicher Verwunderung zu betrachten. Das Wort „vergessen“ steht als starkes Schlusswort, das die unwiderrufliche Natur des Verlustes betont. Es unterstreicht die Erkenntnis, dass die Erfahrungen und Gefühle der Kindheit mit der Zeit verblassen und in Vergessenheit geraten.
Die Kürze und Einfachheit des Gedichts tragen zu seiner Wirkung bei. Holz verzichtet auf komplizierte Metaphern oder ausschmückende Beschreibungen. Stattdessen verwendet er eine reduzierte Sprache, die direkt zum Kern der Emotionen vordringt. Die Pause zwischen „und dann -“ verstärkt das Gefühl des Verlustes und der Endgültigkeit des Vergessens. Das Gedicht ist ein subtiles, aber kraftvolles Beispiel für die Fähigkeit der Poesie, flüchtige Emotionen einzufangen und die universelle Erfahrung des Verlustes und der Erinnerung zu thematisieren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.