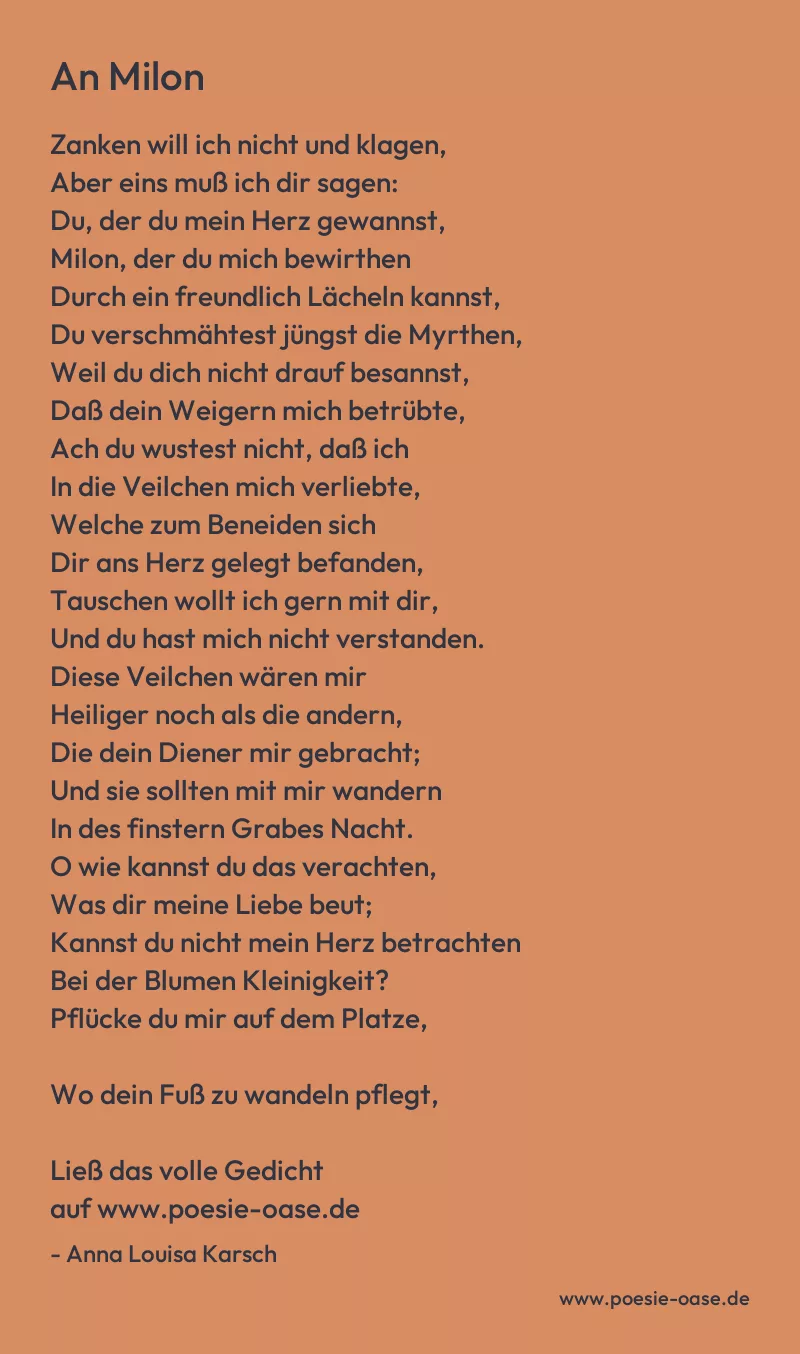An Milon
Zanken will ich nicht und klagen,
Aber eins muß ich dir sagen:
Du, der du mein Herz gewannst,
Milon, der du mich bewirthen
Durch ein freundlich Lächeln kannst,
Du verschmähtest jüngst die Myrthen,
Weil du dich nicht drauf besannst,
Daß dein Weigern mich betrübte,
Ach du wustest nicht, daß ich
In die Veilchen mich verliebte,
Welche zum Beneiden sich
Dir ans Herz gelegt befanden,
Tauschen wollt ich gern mit dir,
Und du hast mich nicht verstanden.
Diese Veilchen wären mir
Heiliger noch als die andern,
Die dein Diener mir gebracht;
Und sie sollten mit mir wandern
In des finstern Grabes Nacht.
O wie kannst du das verachten,
Was dir meine Liebe beut;
Kannst du nicht mein Herz betrachten
Bei der Blumen Kleinigkeit?
Pflücke du mir auf dem Platze,
Wo dein Fuß zu wandeln pflegt,
Blümchen, die der Grasraum trägt,
Und ich mache sie zum Schatze.
Gänseblümchen nähm ich an,
Und ein Zweigchen von den Bäumen,
Die ein jeder nutzen kann;
Wo in lügnerischen Träumen
Sich der arme Kriegesmann
Ausgestreckt am Tische weidet,
Und noch hungert, wenn er wacht,
Und den Reichen noch beneidet,
Der sich Promenaden macht. –
Solch ein Zweigchen, du mein Lieber!
Brich mir im Begegnen ab,
Und ich freue mich darüber,
Weil mirs Milon gab. –
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
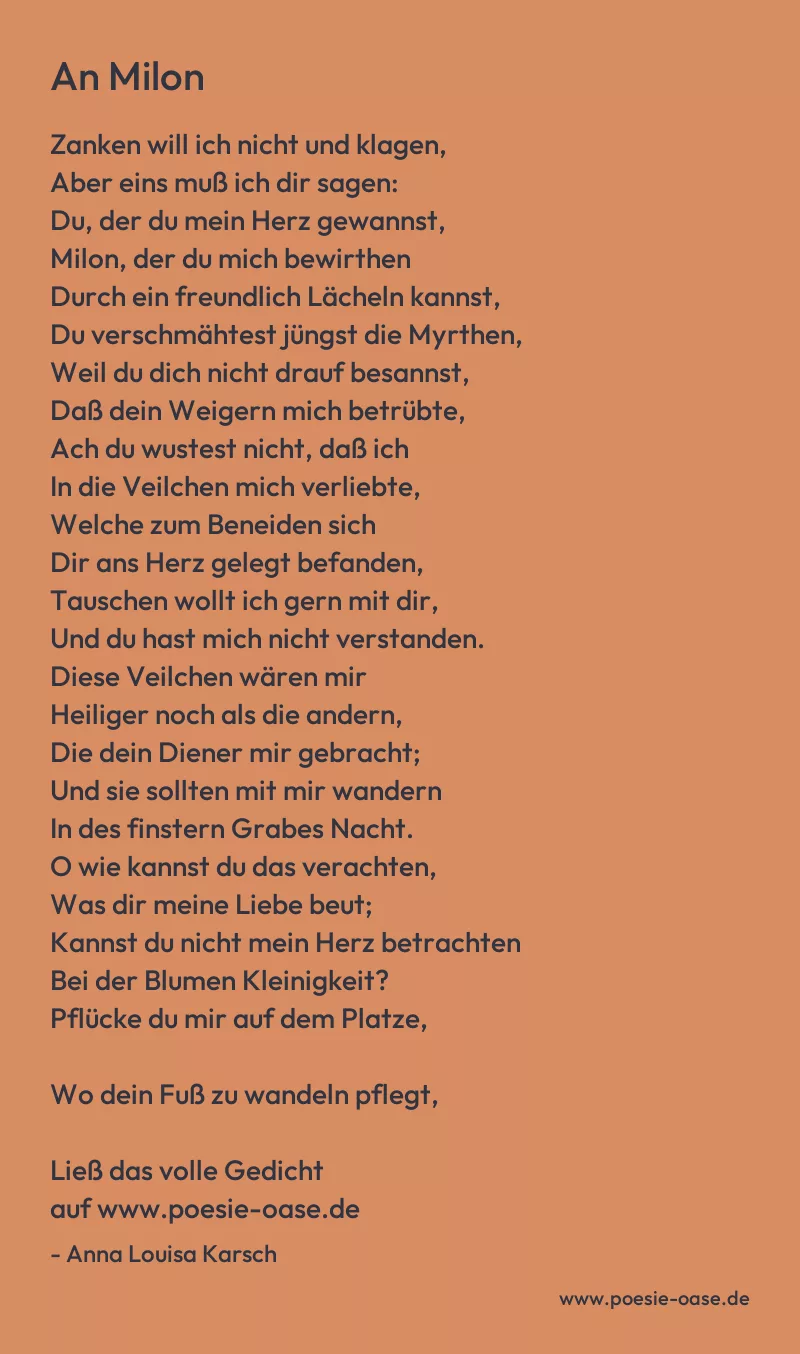
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Milon“ von Anna Louisa Karsch ist eine liebevolle, aber auch etwas klagende Liebeserklärung, die die subtile Kunst der Kommunikation in einer Beziehung thematisiert. Die Dichterin spricht ihren Geliebten, Milon, direkt an und beklagt eine kleine, aber schmerzliche Diskrepanz in ihrer Wahrnehmung und Zuneigung. Es handelt sich um eine intime Betrachtung der Feinheiten, die in einer Liebesbeziehung von Bedeutung sind.
Die zentrale Szene des Gedichts dreht sich um die Ablehnung der Myrthen, die Milon angeboten wurden. Karsch interpretiert dies als eine Missachtung ihrer Gefühle, da sie sich in die bescheidenen Veilchen verliebt hat, die Milon am Herzen getragen wurden. Diese Gegenüberstellung von Myrthen und Veilchen dient als Metapher für unterschiedliche Wertvorstellungen und die Schwierigkeit, die Bedürfnisse des anderen zu verstehen. Die Dichterin wünscht sich, dass Milon ihre Präferenzen und Sehnsüchte erkennen und wertschätzen würde. Sie sehnt sich nach einer Geste, die ihre Liebe und Zuneigung symbolisiert, und betont die tiefe Bedeutung kleiner Aufmerksamkeiten.
Der zweite Teil des Gedichts manifestiert einen tiefen Wunsch nach Verbundenheit und gegenseitigem Verständnis. Karsch erklärt, dass selbst die unscheinbarsten Blumen und Zweige, die von Milon stammen, ihr wertvoller wären als die prächtigsten Geschenke. Sie weist dabei auf die tiefe Bedeutung einfacher Gesten und der Fähigkeit des Partners, ihre Gefühle zu erfassen. Die Referenz an den „armen Kriegesmann“, der sich nach den Freuden des Lebens sehnt, verdeutlicht die Sehnsucht der Dichterin nach einer echten, ungekünstelten Liebe. Sie möchte nicht nur materielle Geschenke, sondern auch die Wertschätzung und die Wertschätzung, die aus der Wahl ihrer Interessen resultieren.
Die Sprache des Gedichts ist geprägt von einer sanften Melancholie, die sich in der Verwendung einfacher Worte und Reimschemata widerspiegelt. Karsch nutzt eine direkte und ehrliche Sprache, um ihre Gefühle auszudrücken. Der Kontrast zwischen den prächtigen Myrthen und den bescheidenen Veilchen, sowie die Betonung der Bedeutung kleiner Gesten, unterstreicht die zentrale Botschaft des Gedichts: wahre Liebe wird durch die Fähigkeit ausgedrückt, die Bedürfnisse und Wünsche des anderen zu verstehen und zu respektieren. Die Dichterin wünscht sich, dass Milon ihre Liebe in ihren kleinen Vorlieben erkennt und eine Geste des Verstehens und der Zuneigung darbietet, die sie in ihren Herzen tragen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.