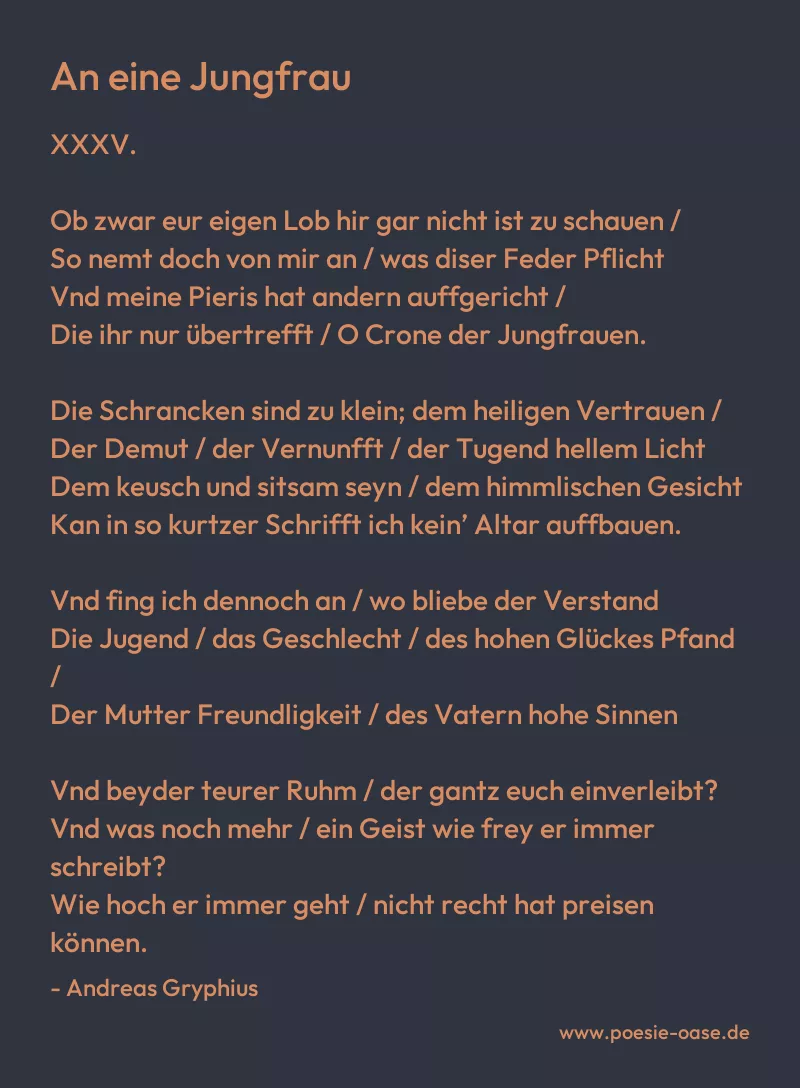An eine Jungfrau
XXXV.
Ob zwar eur eigen Lob hir gar nicht ist zu schauen /
So nemt doch von mir an / was diser Feder Pflicht
Vnd meine Pieris hat andern auffgericht /
Die ihr nur übertrefft / O Crone der Jungfrauen.
Die Schrancken sind zu klein; dem heiligen Vertrauen /
Der Demut / der Vernunfft / der Tugend hellem Licht
Dem keusch und sitsam seyn / dem himmlischen Gesicht
Kan in so kurtzer Schrifft ich kein’ Altar auffbauen.
Vnd fing ich dennoch an / wo bliebe der Verstand
Die Jugend / das Geschlecht / des hohen Glückes Pfand /
Der Mutter Freundligkeit / des Vatern hohe Sinnen
Vnd beyder teurer Ruhm / der gantz euch einverleibt?
Vnd was noch mehr / ein Geist wie frey er immer schreibt?
Wie hoch er immer geht / nicht recht hat preisen können.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
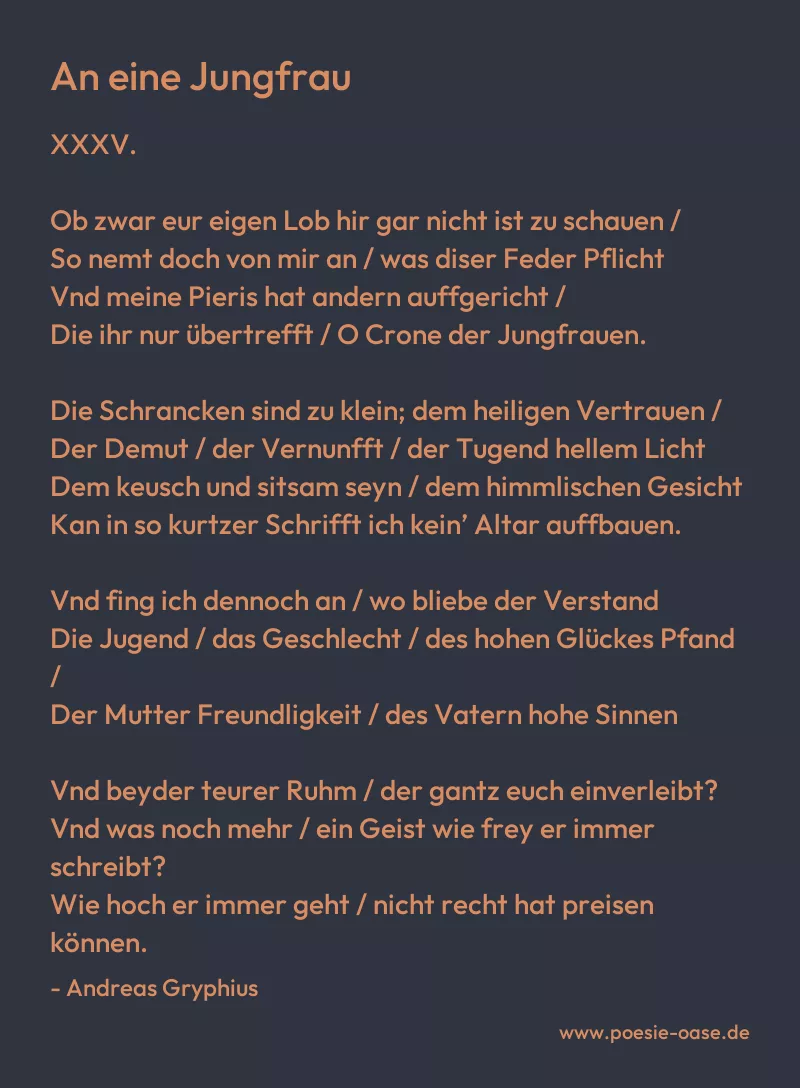
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine Jungfrau“ von Andreas Gryphius ist eine Lobpreisung, die sich an eine ungenannte junge Frau richtet. Gryphius versucht, die Qualitäten und Vorzüge dieser Jungfrau in Worte zu fassen, scheitert aber im Grunde an der Überforderung der Aufgabe. Die Verse spiegeln eine tiefe Bewunderung und Respekt wider, die durch die konsequente Überhöhung der angesprochenen Person zum Ausdruck kommt.
Der Dichter betont zunächst, dass die eigentlichen Lobenswerte der Jungfrau, wie Tugend und Anmut, nicht durch seine Feder und seine Musen erfasst werden können. Die „Schranken“ der Sprache und die Begrenztheit des Gedichts werden als unzureichend dargestellt, um die „Demut“, die „Vernunfft“, die „Tugend“ und das „himmlische Gesicht“ adäquat zu würdigen. Gryphius stellt fest, dass er nicht in der Lage ist, einen „Altar“ für diese Qualitäten zu errichten, was die metaphysische Dimension der Verehrung unterstreicht.
In den folgenden Versen wird die Unfähigkeit des Dichters, die Jungfrau angemessen zu preisen, weiter ausgeführt. Er zählt eine Reihe von Faktoren auf, die in ihren Vorzügen vereint sind: „die Jugend“, „das Geschlecht“, „des hohen Glückes Pfand“, „der Mutter Freundligkeit“ und „des Vatern hohe Sinnen“. Diese Aufzählung dient dazu, die Breite und Tiefe der Vorzüge der Jungfrau zu verdeutlichen, die das Gedicht nicht erfassen kann.
Abschließend erkennt Gryphius, dass selbst der freie Geist des Schreibens, egal wie hoch er sich erhebt, die Jungfrau nicht vollständig preisen kann. Dies deutet darauf hin, dass die Verehrung über die Grenzen der menschlichen Sprache und Vorstellungskraft hinausgeht. Das Gedicht endet mit der Erkenntnis, dass die Jungfrau so erhaben ist, dass ihre Qualitäten die Fähigkeit der Worte übersteigen. Die eigentliche Botschaft des Gedichts ist somit weniger ein Lobgesang als eine Feststellung der Grenzen der menschlichen Sprache und des Respekts vor etwas Unergründlichem.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.