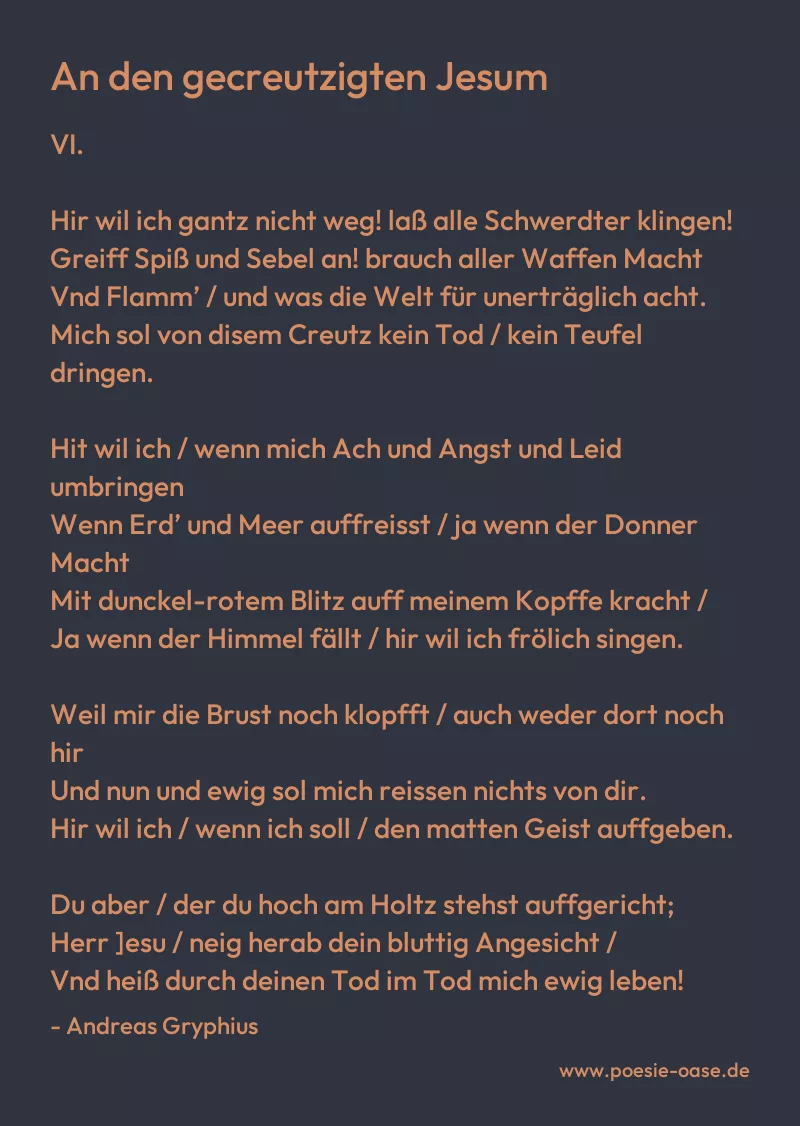An den gecreutzigten Jesum
VI.
Hir wil ich gantz nicht weg! laß alle Schwerdter klingen!
Greiff Spiß und Sebel an! brauch aller Waffen Macht
Vnd Flamm’ / und was die Welt für unerträglich acht.
Mich sol von disem Creutz kein Tod / kein Teufel dringen.
Hit wil ich / wenn mich Ach und Angst und Leid umbringen
Wenn Erd’ und Meer auffreisst / ja wenn der Donner Macht
Mit dunckel-rotem Blitz auff meinem Kopffe kracht /
Ja wenn der Himmel fällt / hir wil ich frölich singen.
Weil mir die Brust noch klopfft / auch weder dort noch hir
Und nun und ewig sol mich reissen nichts von dir.
Hir wil ich / wenn ich soll / den matten Geist auffgeben.
Du aber / der du hoch am Holtz stehst auffgericht;
Herr ]esu / neig herab dein bluttig Angesicht /
Vnd heiß durch deinen Tod im Tod mich ewig leben!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
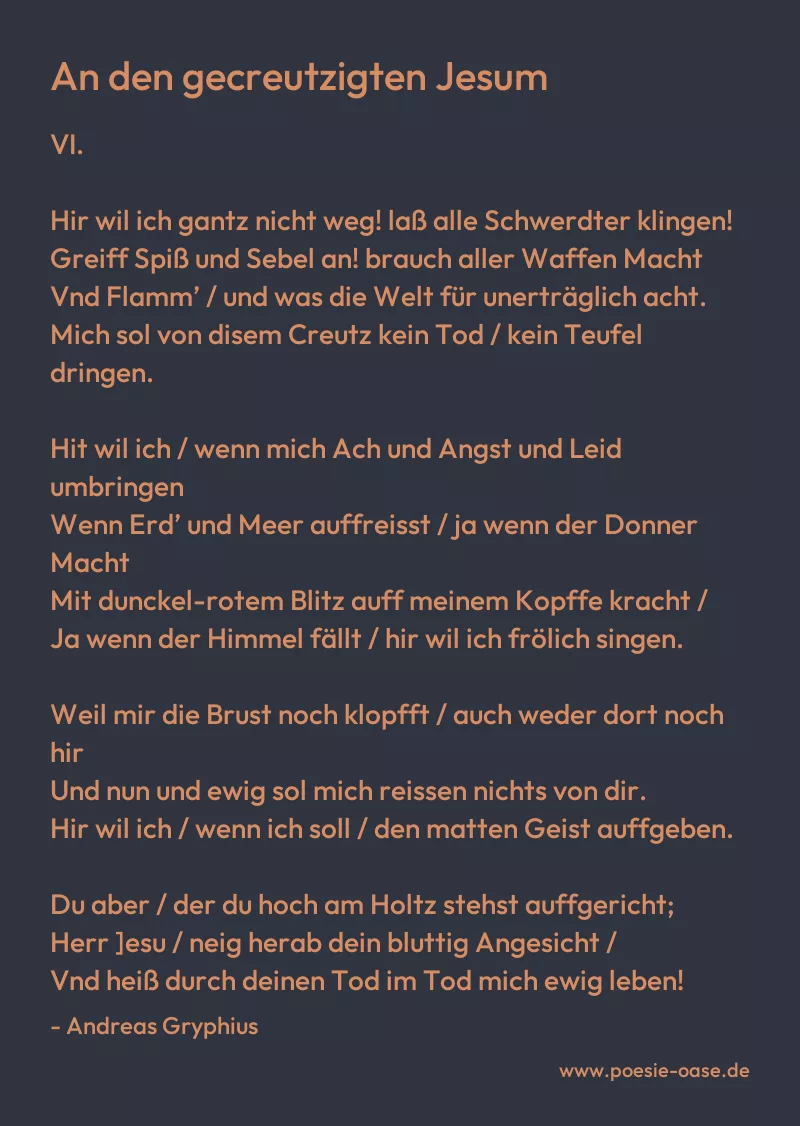
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den gecreutzigten Jesum“ von Andreas Gryphius ist ein kraftvolles Bekenntnis zum Glauben und zur unerschütterlichen Hingabe an Jesus Christus, selbst angesichts von Tod und Verdammnis. Es spiegelt die tiefe Religiosität der Barockzeit wider, in der das Leid Christi und die Erwartung des Jenseits zentrale Themen waren. Die Struktur des Gedichts, mit seinen strengen Sonett-Form, unterstreicht die Ernsthaftigkeit und die innere Ordnung des Glaubens.
Die ersten acht Verse, die sogenannte Oktave, drücken die Entschlossenheit des lyrischen Ichs aus, am Kreuz Christi festzuhalten, egal welche äußeren Umstände drohen. Die Zeilen sind von einer starken Bildsprache geprägt: Schwerter, Speere, Säbel, Feuer, all das symbolisiert die Macht des Bösen und die Anfeindungen der Welt. Trotz dieser drohenden Gefahren weigert sich das lyrische Ich, von seinem Glauben abzulassen. Die Verwendung des Imperativs „laß“ und der wiederholte Satz „Hir wil ich“ (Hier will ich) unterstreichen diese unerschütterliche Haltung. Selbst Naturkatastrophen wie Erdbeben, Meeresaufbrüche, Blitze und der Sturz des Himmels können das lyrische Ich nicht von seinem Bekenntnis abbringen. Es wird sogar „frölich singen“, also trotz allem Leid Freude empfinden.
Die zweite Strophe, das Sextett, verdeutlicht das unerschütterliche Festhalten am Glauben. Die Wiederholung von „Hir wil ich“ und die Betonung, dass nichts, weder „dort noch hir“, das lyrische Ich von Christus trennen soll, verstärken die unerschütterliche Bindung. Der Wunsch, im Tod den „matten Geist aufzugeben“ und im Angesicht des Gekreuzigten zu sterben, zeigt die tiefe Sehnsucht nach Erlösung und ewiger Gemeinschaft mit Gott. Der Tod wird nicht als Ende, sondern als Übergang in die ewige Seligkeit gesehen.
Die letzten drei Verse sind eine direkte Anrufung an Jesus, dem Gekreuzigten. Der Dichter bittet um die Zuwendung Jesu, um dessen „bluttig Angesicht“. Die Bitte, durch den Tod Jesu ewiges Leben zu erfahren, verdeutlicht die zentrale Bedeutung des Opfertodes Christi für die christliche Erlösung. Das Gedicht ist somit eine eindringliche Mahnung zur Glaubensfestigkeit und ein Zeugnis der Hoffnung auf ewiges Leben durch die Hingabe an Jesus Christus. Es zeigt die tiefe Verwurzelung im christlichen Glauben und die Bereitschaft, selbst im Angesicht des Todes an diesem Glauben festzuhalten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.