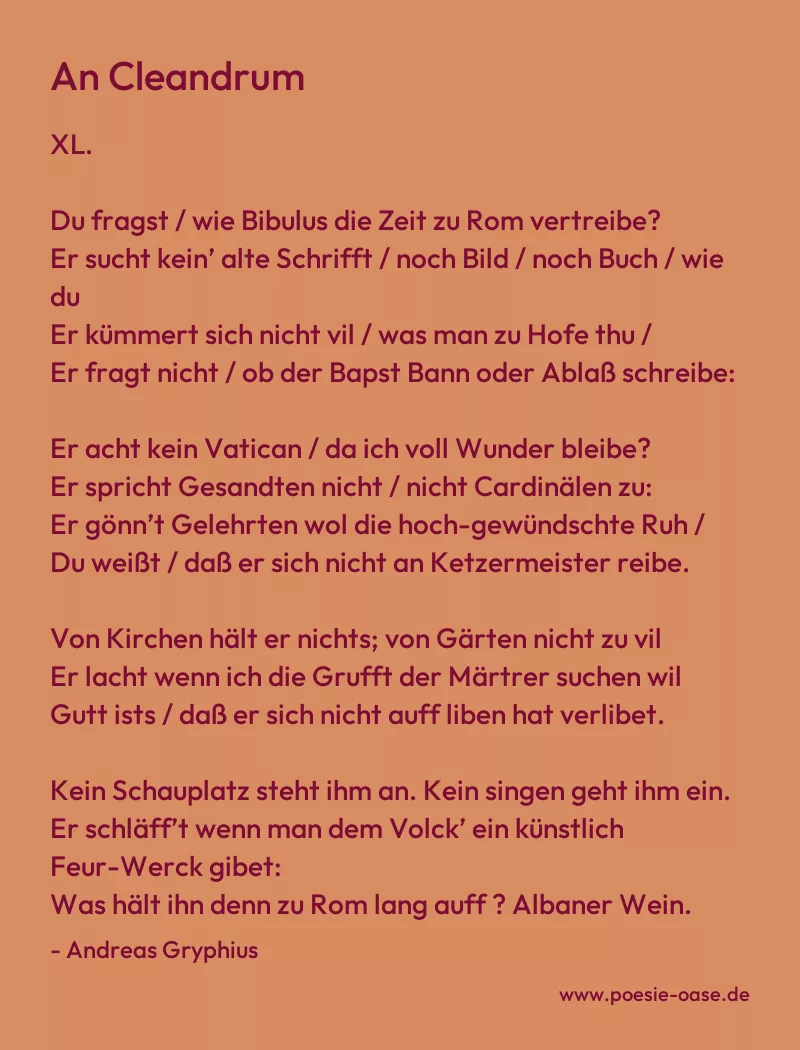An Cleandrum
XL.
Du fragst / wie Bibulus die Zeit zu Rom vertreibe?
Er sucht kein’ alte Schrifft / noch Bild / noch Buch / wie du
Er kümmert sich nicht vil / was man zu Hofe thu /
Er fragt nicht / ob der Bapst Bann oder Ablaß schreibe:
Er acht kein Vatican / da ich voll Wunder bleibe?
Er spricht Gesandten nicht / nicht Cardinälen zu:
Er gönn’t Gelehrten wol die hoch-gewündschte Ruh /
Du weißt / daß er sich nicht an Ketzermeister reibe.
Von Kirchen hält er nichts; von Gärten nicht zu vil
Er lacht wenn ich die Grufft der Märtrer suchen wil
Gutt ists / daß er sich nicht auff liben hat verlibet.
Kein Schauplatz steht ihm an. Kein singen geht ihm ein.
Er schläff’t wenn man dem Volck’ ein künstlich Feur-Werck gibet:
Was hält ihn denn zu Rom lang auff ? Albaner Wein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
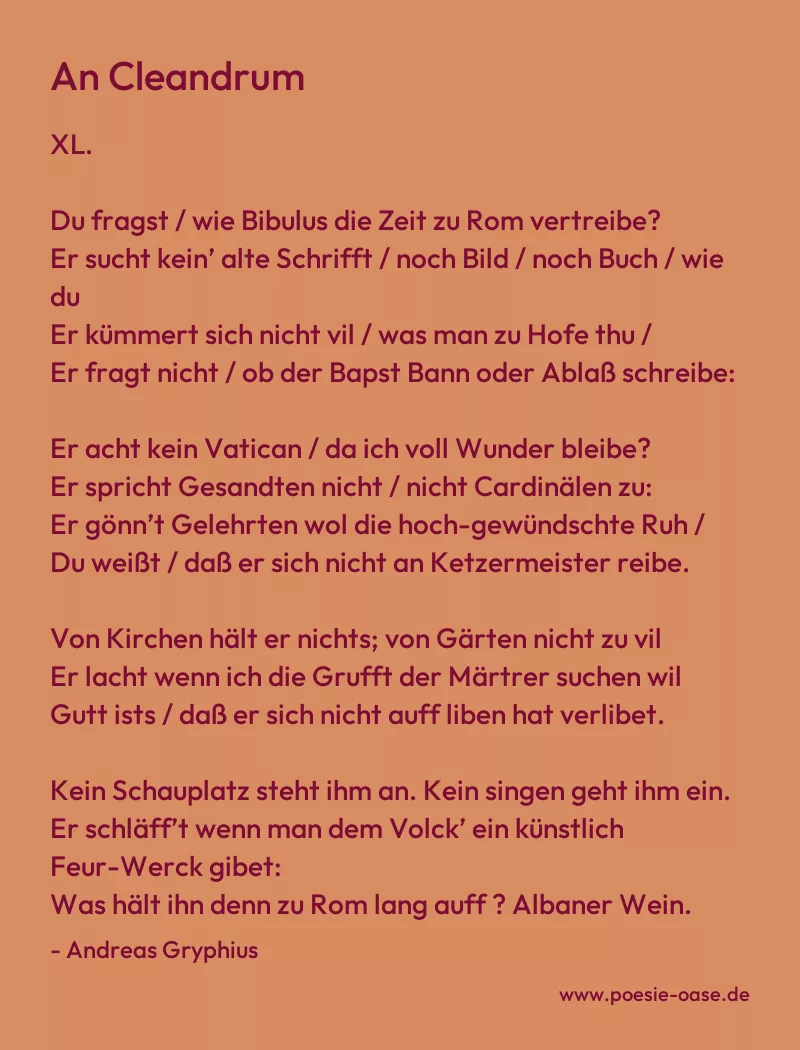
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Cleandrum“ von Andreas Gryphius zeichnet ein ironisches Porträt des römischen Lebens, indem es die Interessen einer Figur namens Bibulus kontrastiert mit den kulturellen und spirituellen Aktivitäten, die der Dichter selbst schätzt. Die ersten Strophen widmen sich der Aufzählung all dessen, was Bibulus nicht tut oder beachtet, um dann im abschließenden Quartett die überraschende Antwort zu geben, was ihn stattdessen in Rom festhält: Albaner Wein. Die Verwendung eines rhetorischen Fragespiels, „Du fragst / wie Bibulus die Zeit zu Rom vertreibe?“, leitet das Gedicht ein und lenkt die Aufmerksamkeit auf die ungewöhnlichen Vorlieben von Bibulus.
Die Ironie des Gedichts liegt in der Gegenüberstellung von Bibulus‘ Desinteresse an Bildung, Religion, Kunst und Liebe mit den Interessen des lyrischen Ichs, das all diese Bereiche schätzt. Während Gryphius Gelehrsamkeit, die Suche nach Reliquien, Gärten und Theateraufführungen sowie die Liebe hochhält, zeigt Bibulus keinerlei Neigung zu diesen Dingen. Er verweigert sich der Teilnahme an den kulturellen und spirituellen Praktiken, die für Gryphius von Bedeutung sind. Die Aufzählung dieser kulturellen Bezüge, wie zum Beispiel die Erwähnung des Vatikans, der Gesandten und der Gelehrten, verstärkt den Kontrast und die Ironie. Die Haltung von Bibulus gegenüber den „Ketzermeistern“ könnte man dabei als Distanzierung von religiösen Streitigkeiten interpretieren.
Das Gedicht nutzt sprachliche Mittel wie die Aufzählung, um die Abwesenheit von Bibulus‘ Interesse an den üblichen kulturellen Aktivitäten zu betonen. Die Verwendung des Reimes und der klaren Struktur eines Sonetts verleiht dem Text eine besondere Form, die den Kontrast zusätzlich hervorhebt. Die Kürze der einzelnen Zeilen und die prägnante Sprache tragen zur Ironie bei. Der überraschende Schluss mit der Nennung des Albaner Weins als einzige Erklärung für Bibulus‘ Aufenthalt in Rom kehrt die Erwartungen des Lesers um und liefert eine humorvolle Auflösung des vorher aufgebauten Spannungsbogens.
Die abschließende Pointe des Gedichts, der Albaner Wein, stellt eine überraschende und humorvolle Auflösung dar. Sie deutet darauf hin, dass Bibulus die Freuden des irdischen Lebens, insbesondere den Genuss des Weins, über die Beschäftigung mit geistigen oder kulturellen Dingen stellt. Dies kann als eine Kritik an der übertriebenen Ernsthaftigkeit und dem Eifer interpretiert werden, mit dem Gryphius und seine Zeitgenossen oft die Welt betrachteten. Die Ironie liegt darin, dass ausgerechnet das profane Vergnügen des Trinkens die einzige Motivation für Bibulus‘ Verbleib in Rom darstellt, während all die anderen, vermeintlich höheren Werte für ihn irrelevant sind. Das Gedicht bietet somit eine pointierte Reflexion über die menschliche Natur und die Vielfalt der Lebensansätze.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.