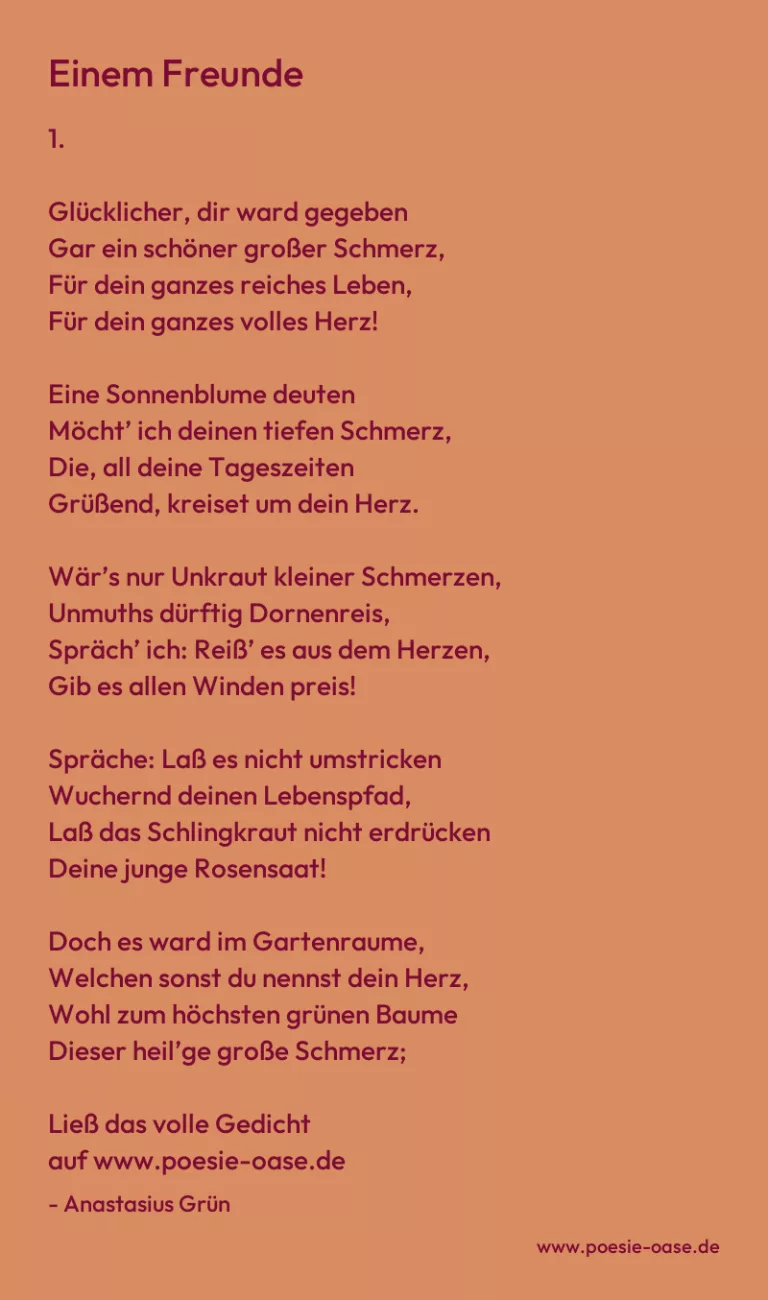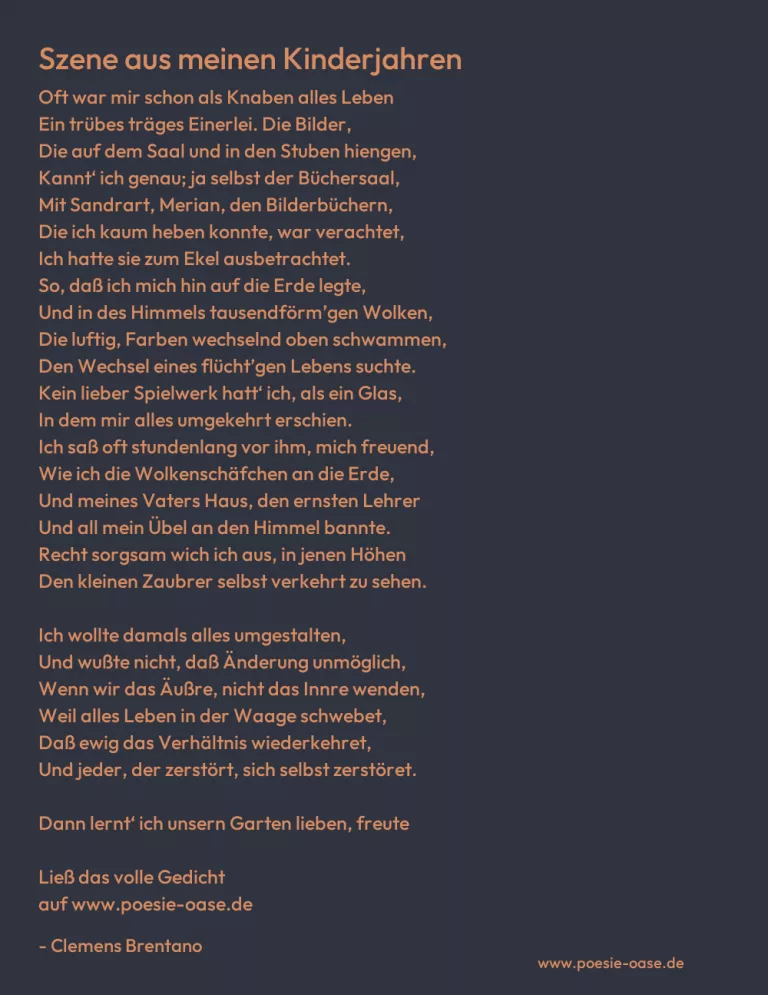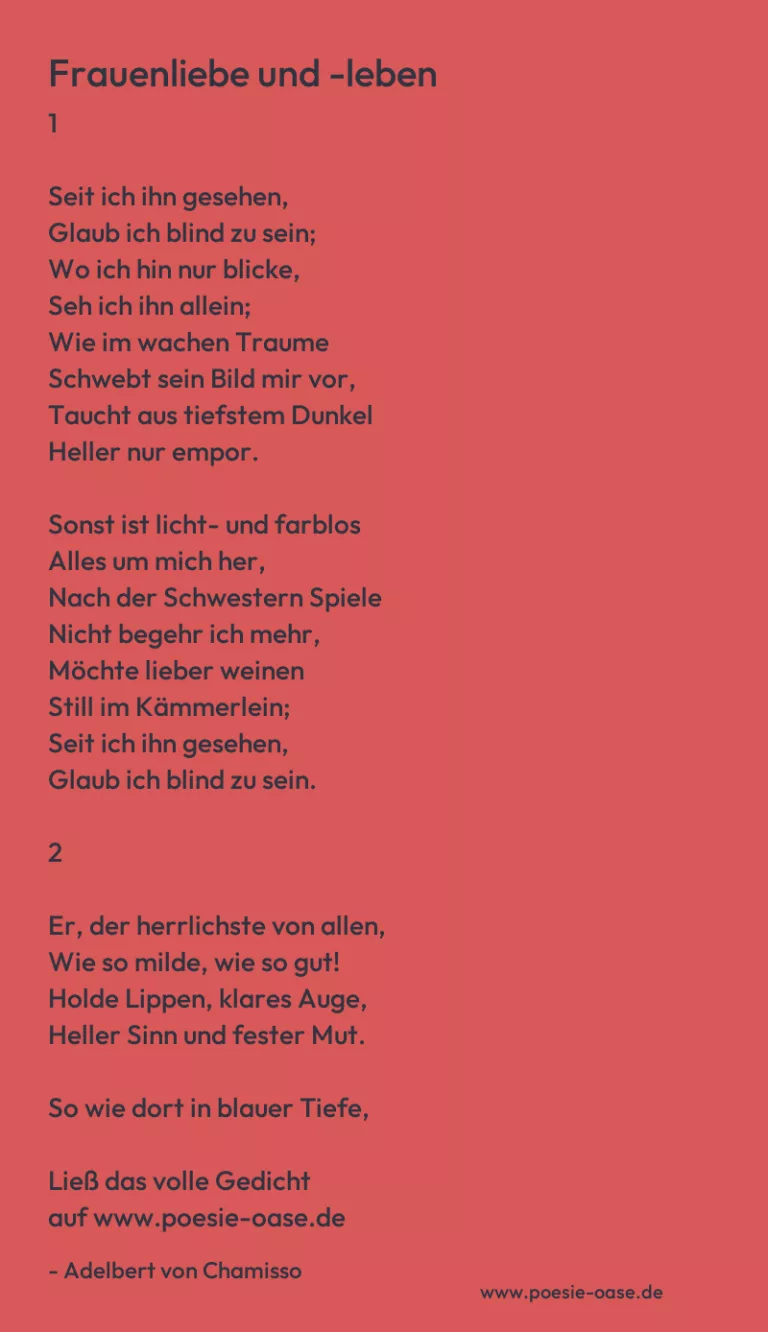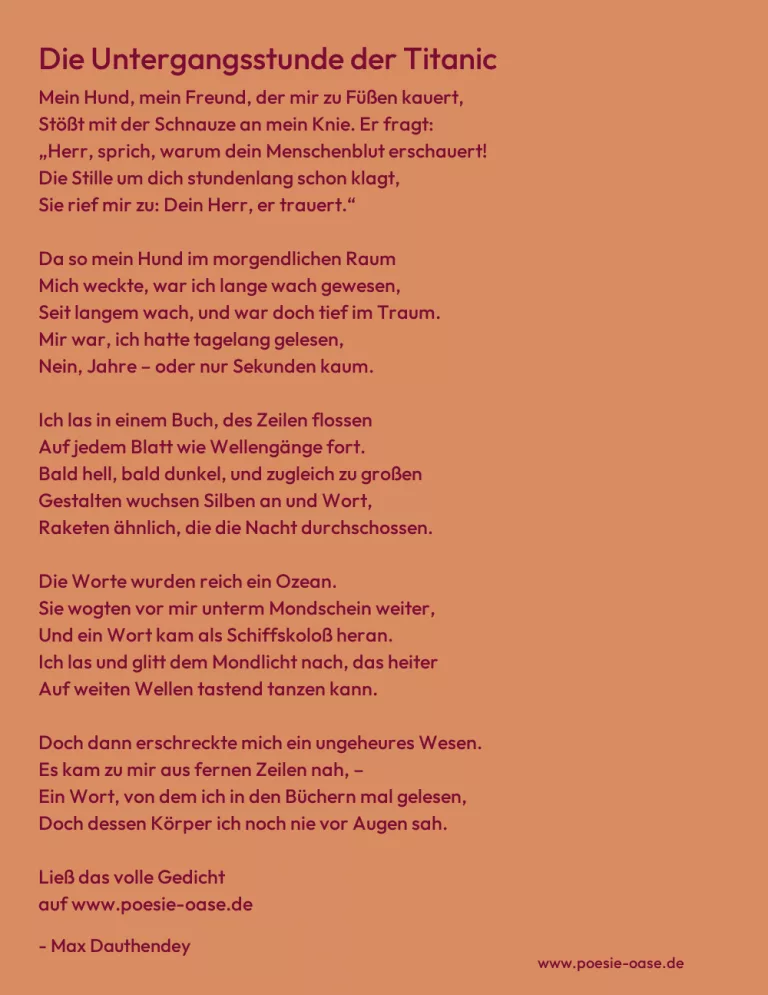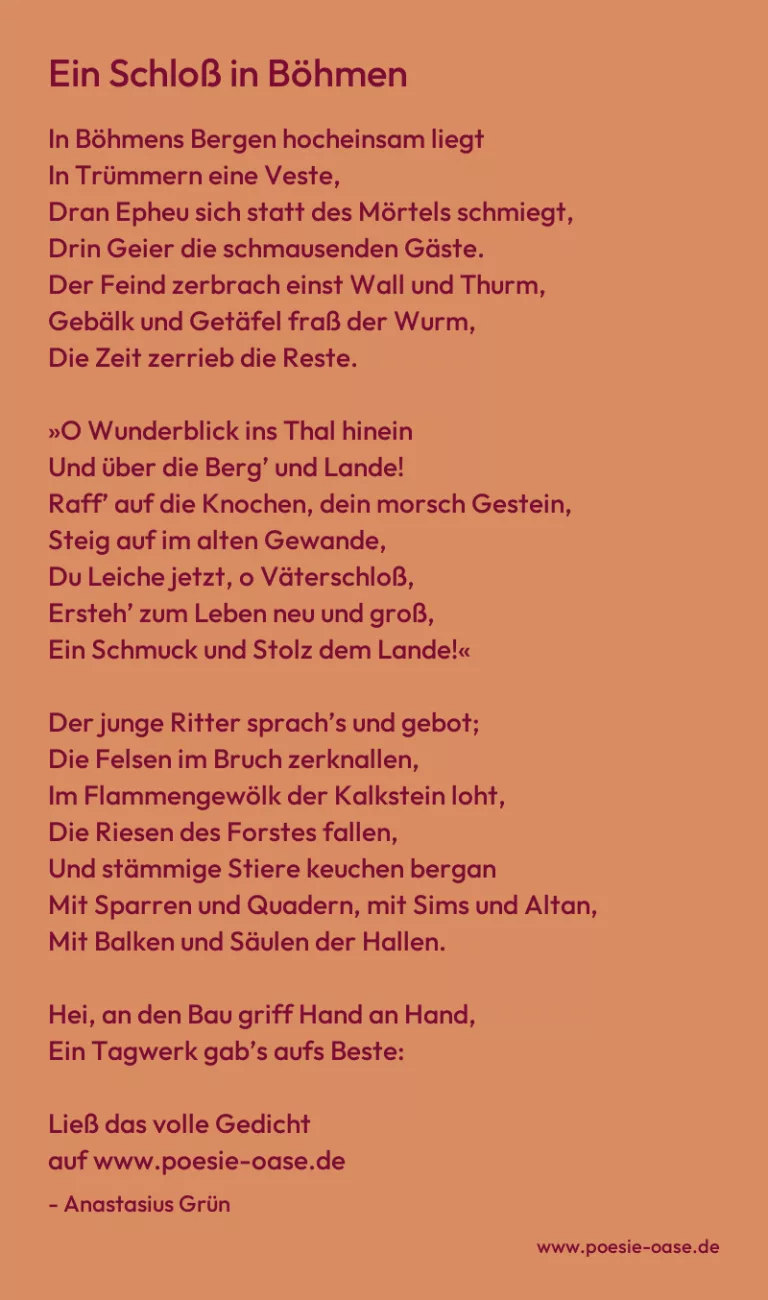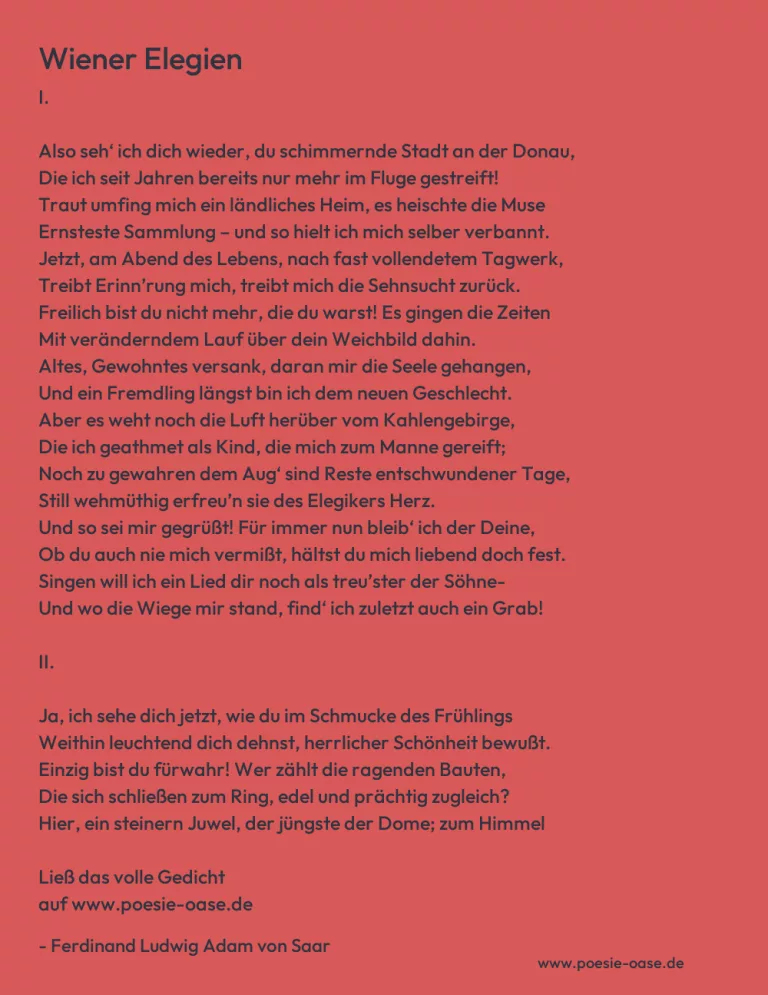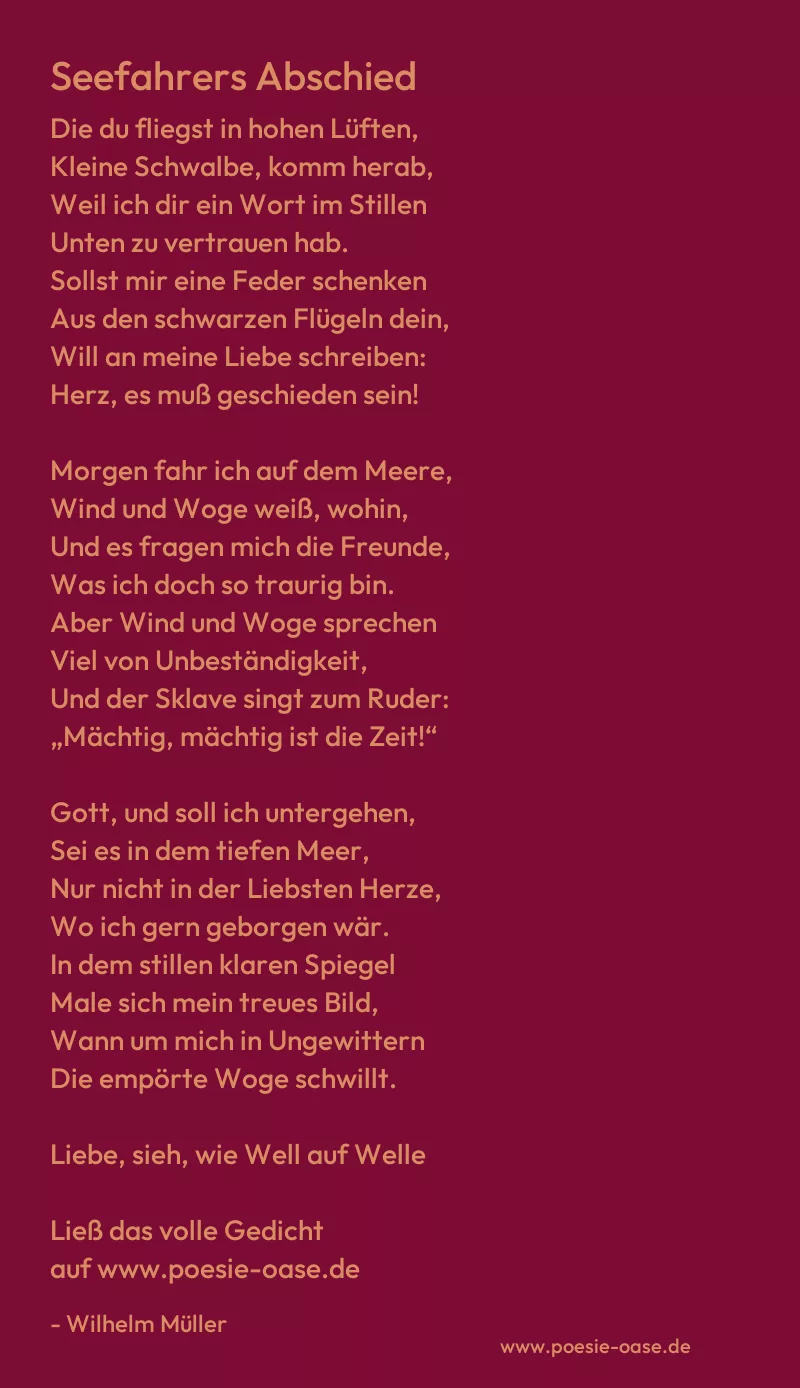Die du fliegst in hohen Lüften,
Kleine Schwalbe, komm herab,
Weil ich dir ein Wort im Stillen
Unten zu vertrauen hab.
Sollst mir eine Feder schenken
Aus den schwarzen Flügeln dein,
Will an meine Liebe schreiben:
Herz, es muß geschieden sein!
Morgen fahr ich auf dem Meere,
Wind und Woge weiß, wohin,
Und es fragen mich die Freunde,
Was ich doch so traurig bin.
Aber Wind und Woge sprechen
Viel von Unbeständigkeit,
Und der Sklave singt zum Ruder:
„Mächtig, mächtig ist die Zeit!“
Gott, und soll ich untergehen,
Sei es in dem tiefen Meer,
Nur nicht in der Liebsten Herze,
Wo ich gern geborgen wär.
In dem stillen klaren Spiegel
Male sich mein treues Bild,
Wann um mich in Ungewittern
Die empörte Woge schwillt.
Liebe, sieh, wie Well auf Welle
Ringt nach dem ersehnten Strand:
Aber manche wird verschlungen,
Eh sie küßt das grüne Land.
Wenn du an dem Ufer wandelst,
Hüpft die Flut nach deinem Fuß:
Wogen hab ich nur und Winde,
Dir zu schicken meinen Gruß.
Wann die fernen Höhen dämmern,
Jauchzet alles nach dem Land:
Nur zwei müde Augen bleiben
Still dem Meere zugewandt.
Wann die Segel wieder glänzen,
Wann die Winde heimwärts wehn,
Laß mich auf dem Maste sitzen:
Liebe kann durch Wolken sehn.