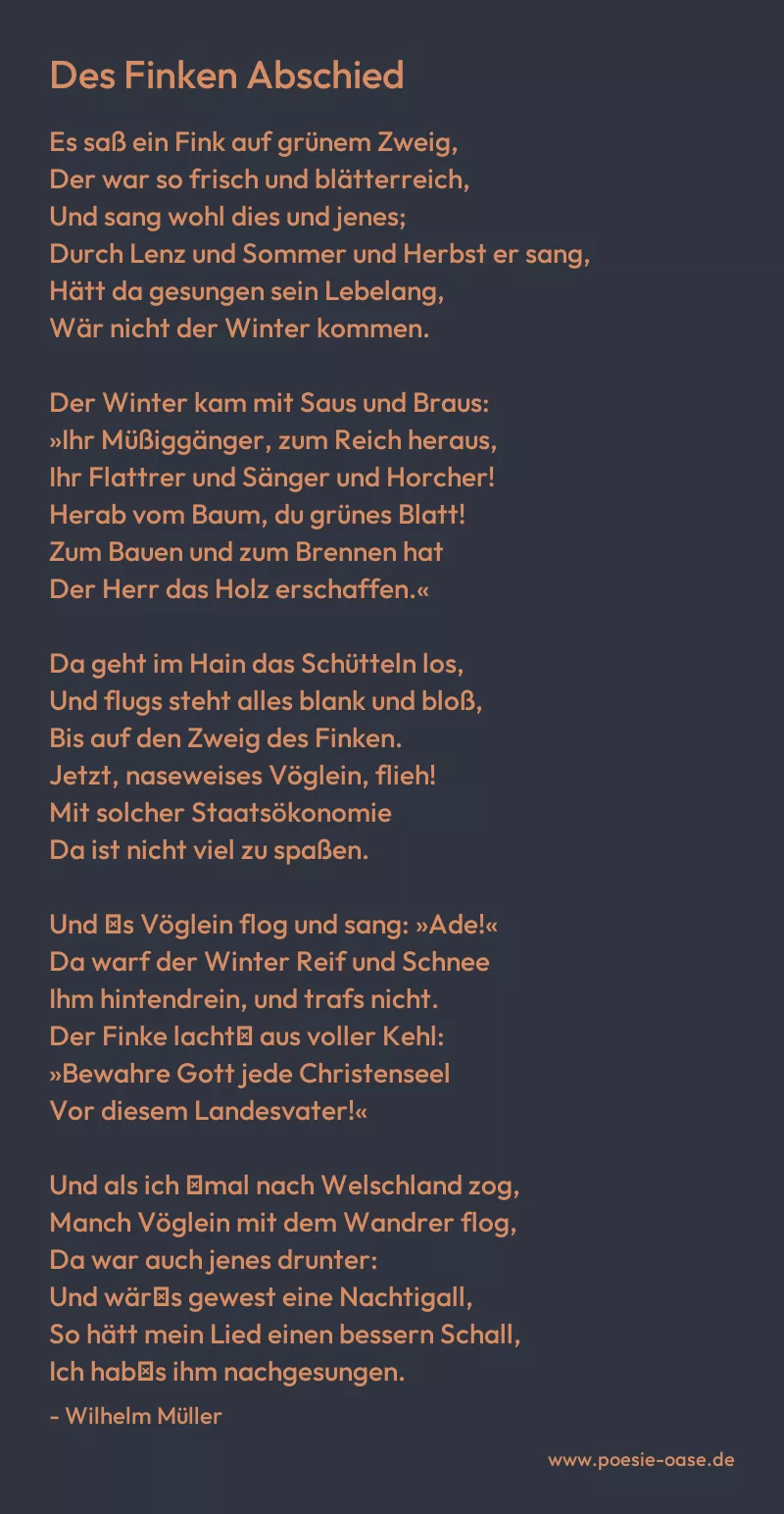Des Finken Abschied
Es saß ein Fink auf grünem Zweig,
Der war so frisch und blätterreich,
Und sang wohl dies und jenes;
Durch Lenz und Sommer und Herbst er sang,
Hätt da gesungen sein Lebelang,
Wär nicht der Winter kommen.
Der Winter kam mit Saus und Braus:
»Ihr Müßiggänger, zum Reich heraus,
Ihr Flattrer und Sänger und Horcher!
Herab vom Baum, du grünes Blatt!
Zum Bauen und zum Brennen hat
Der Herr das Holz erschaffen.«
Da geht im Hain das Schütteln los,
Und flugs steht alles blank und bloß,
Bis auf den Zweig des Finken.
Jetzt, naseweises Vöglein, flieh!
Mit solcher Staatsökonomie
Da ist nicht viel zu spaßen.
Und ′s Vöglein flog und sang: »Ade!«
Da warf der Winter Reif und Schnee
Ihm hintendrein, und trafs nicht.
Der Finke lacht′ aus voller Kehl:
»Bewahre Gott jede Christenseel
Vor diesem Landesvater!«
Und als ich ′mal nach Welschland zog,
Manch Vöglein mit dem Wandrer flog,
Da war auch jenes drunter:
Und wär′s gewest eine Nachtigall,
So hätt mein Lied einen bessern Schall,
Ich hab′s ihm nachgesungen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
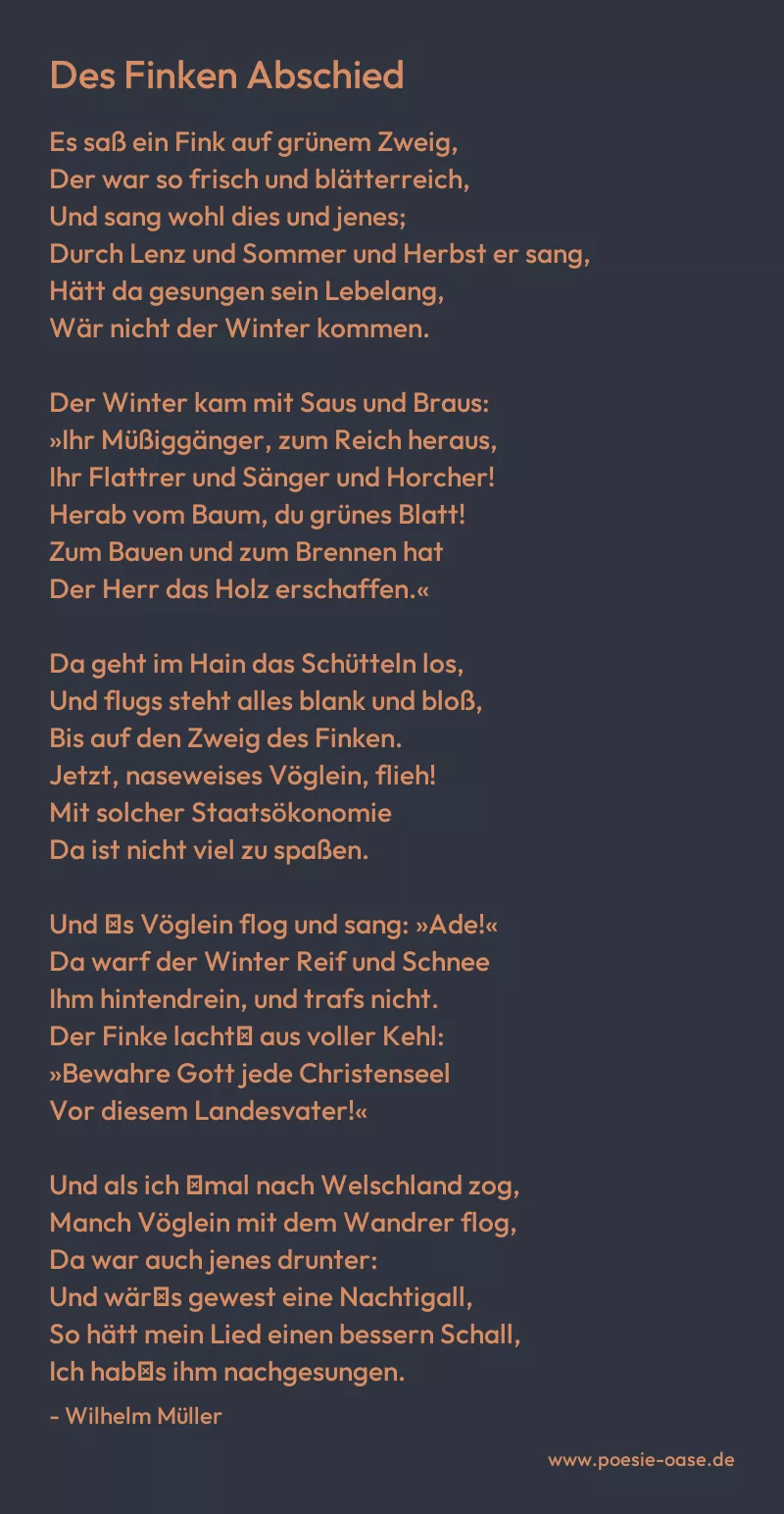
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Des Finken Abschied“ von Wilhelm Müller entfaltet in vier Strophen eine kleine Geschichte, die den Abschied eines Finken von seinem gewohnten Umfeld und die Konfrontation mit der kalten Realität des Winters beschreibt. Das Gedicht beginnt idyllisch mit der Darstellung des Finken, der auf einem grünen Zweig sitzt und munter singt. Diese anfängliche Harmonie, die durch die frische Natur und den Gesang des Vogels erzeugt wird, wird jedoch abrupt durch den Einbruch des Winters unterbrochen.
Der Winter wird in der zweiten Strophe als eine unbarmherzige und gebieterische Figur dargestellt, die das Ende der unbeschwerten Zeit ankündigt. Mit „Saus und Braus“ und der Aufforderung an die „Müßiggänger“ und „Flattrer“, das Reich zu verlassen, wird der Winter als Gegenspieler des Frühlings und Sommers etabliert. Die radikale Veränderung der Natur, das „Schütteln“ des Hains und das „blank und bloß“ Stehen der Bäume, symbolisieren den Verlust der Lebensgrundlage und die Notwendigkeit für den Finken, zu handeln und zu fliehen.
Die dritte Strophe zeigt den Finken in der Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit des Abschieds. Der Wink mit der „Staatsökonomie“ des Winters, der kein Verständnis für die Freude am Gesang und an der unbeschwerten Zeit hat, unterstreicht die Kontrastierung von Leichtigkeit und Ernst. Der Finke reagiert mit Trotz und fliegt davon, begleitet von dem Abschiedsruf „Ade!“. Der Winter versucht, ihn mit Reif und Schnee zu treffen, scheitert jedoch. Die abschließenden Verse des Finken drücken eine trotzige Freude und eine ironische Distanz zum Winter aus, der als „Landesvater“ verspottet wird.
Die vierte Strophe fügt eine persönliche Reflexion des Erzählers hinzu, der das Gedicht abschließt. Die Erinnerung an eine Reise nach „Welschland“, bei der er mehrere Vögel, darunter auch den Finken, wieder traf, zeigt die universelle Erfahrung von Abschied und Neubeginn. Der letzte Vers „Ich hab′s ihm nachgesungen“ deutet an, dass der Erzähler das Lied des Finken in sein eigenes, menschliches Erleben integriert und ihm somit eine weitere Dimension der Bedeutung verleiht. Das Gedicht thematisiert also nicht nur den Abschied eines Vogels, sondern auch die menschliche Erfahrung von Verlust, Widerstand und der Fähigkeit, sich an veränderte Umstände anzupassen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.