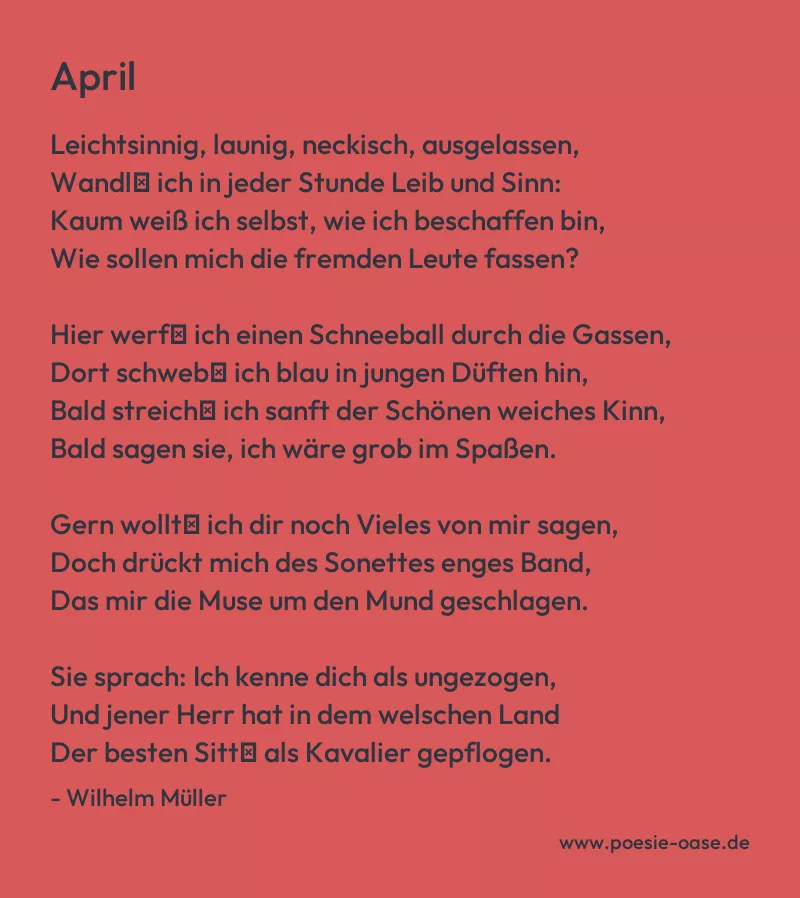April
Leichtsinnig, launig, neckisch, ausgelassen,
Wandl′ ich in jeder Stunde Leib und Sinn:
Kaum weiß ich selbst, wie ich beschaffen bin,
Wie sollen mich die fremden Leute fassen?
Hier werf′ ich einen Schneeball durch die Gassen,
Dort schweb′ ich blau in jungen Düften hin,
Bald streich′ ich sanft der Schönen weiches Kinn,
Bald sagen sie, ich wäre grob im Spaßen.
Gern wollt′ ich dir noch Vieles von mir sagen,
Doch drückt mich des Sonettes enges Band,
Das mir die Muse um den Mund geschlagen.
Sie sprach: Ich kenne dich als ungezogen,
Und jener Herr hat in dem welschen Land
Der besten Sitt′ als Kavalier gepflogen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
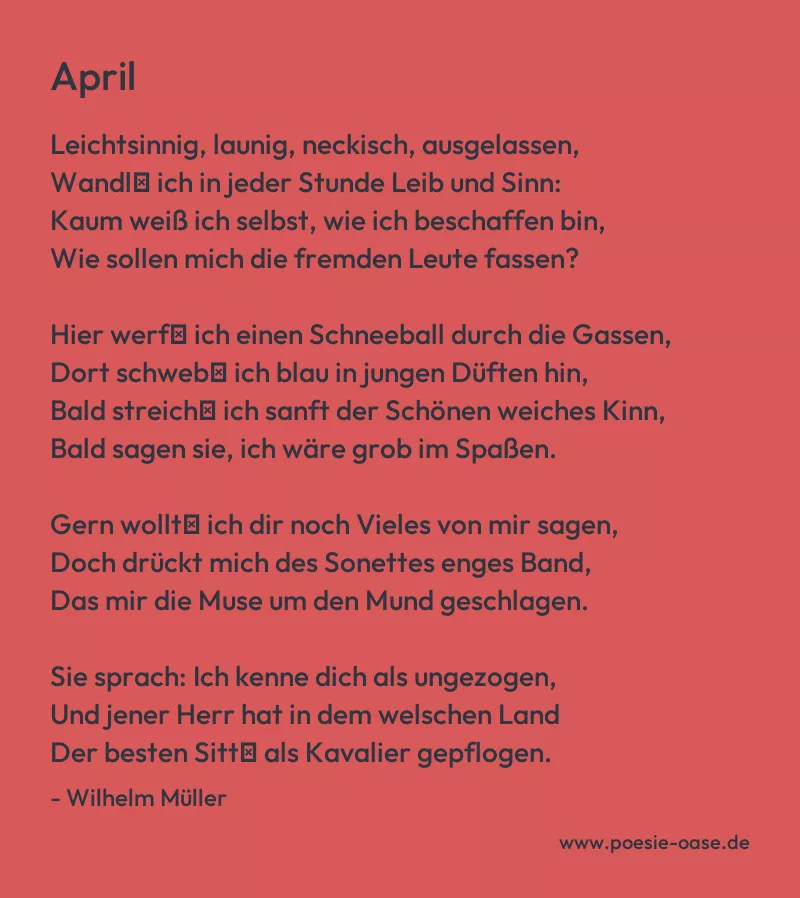
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „April“ von Wilhelm Müller ist eine charmante Selbstbeschreibung, die die widersprüchlichen und unbeständigen Eigenschaften des Monats April mit einer leichten, spielerischen Feder einfängt. Das Gedicht präsentiert den April als eine Figur, die zwischen Leichtfertigkeit und Ernst, Zuneigung und Grobheit schwankt. Diese Ambivalenz wird durch eine Reihe von Gegensätzen ausgedrückt, die in den ersten beiden Quartetten des Sonetts aufscheinen. Der April wird als „leichtsinnig, launig, neckisch, ausgelassen“ beschrieben, aber auch als jemand, der „in jeder Stunde Leib und Sinn“ wandelt, was seine Unberechenbarkeit unterstreicht.
Die Metapher des „Schneeballwerfens“ und des „Schwebens in jungen Düften“ verdeutlicht die kindliche Freude und Unbeschwertheit des Aprils. Gleichzeitig deutet die Zeile „Bald streich′ ich sanft der Schönen weiches Kinn, / Bald sagen sie, ich wäre grob im Spaßen“ auf seine Fähigkeit hin, sowohl zärtlich als auch ungehobelt zu sein. Diese Doppelgesichtigkeit wird durch die Verwendung von Adjektiven wie „leichtsinnig“ und „großzügig“ betont, die die Vielfalt der Gefühle und Verhaltensweisen widerspiegeln, die mit dem April verbunden sind. Die Frage „Wie sollen mich die fremden Leute fassen?“ deutet auf die Schwierigkeit hin, den April in seiner Gänze zu verstehen oder zu beurteilen.
Im Terzett des Gedichts wendet sich der Sprecher direkt an den Leser und drückt den Wunsch aus, mehr von sich zu erzählen. Dies wird jedoch durch das „enges Band“ des Sonetts eingeschränkt. Hier wird das Gedicht zu einem Meta-Kommentar über seine eigene Form, indem die Einschränkungen des Sonetts als eine Metapher für die Begrenzung der Selbstausdrucks- und Selbstdarstellungsmöglichkeiten gesehen werden. Dies verleiht dem Gedicht eine zusätzliche Ebene der Reflexivität, indem es die Art und Weise thematisiert, wie sich der April selbst durch die Regeln des literarischen Formats präsentiert.
Das abschließende Terzett enthält eine humorvolle Pointe, die die „Muse“ als eine Figur einführt, die den April als „ungezogen“ kennt und ihn mit einem „Kavalier“ aus dem „welschen Land“ kontrastiert, der „der besten Sitt′“ gepflegt hat. Dies verstärkt das Bild des Aprils als einer Figur, die sich sowohl durch jugendliche Unbekümmertheit als auch durch eine gewisse Widerspenstigkeit auszeichnet. Durch diese Kontrastierung und die spielerische Selbstironie wird der April als eine Figur dargestellt, die sich den Erwartungen entzieht und stattdessen die Unvorhersehbarkeit und den Reiz der Wandlung feiert. Das Gedicht zeichnet somit ein lebendiges Bild des Aprils, das sowohl seine spielerische Natur als auch seine Vielschichtigkeit hervorhebt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.