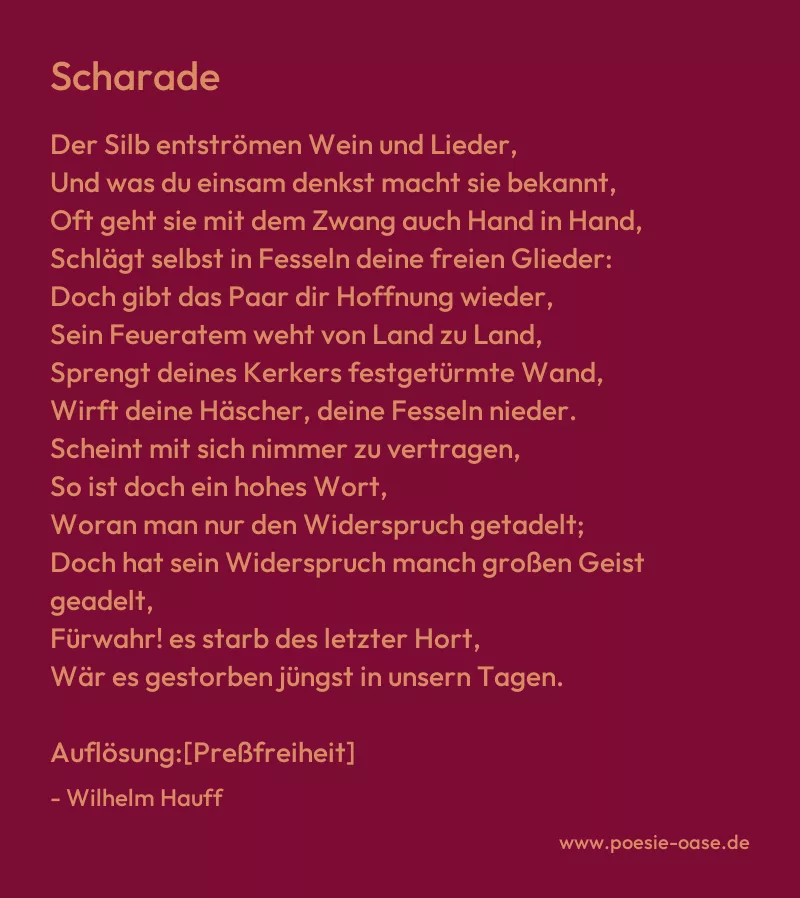Scharade
Der Silb entströmen Wein und Lieder,
Und was du einsam denkst macht sie bekannt,
Oft geht sie mit dem Zwang auch Hand in Hand,
Schlägt selbst in Fesseln deine freien Glieder:
Doch gibt das Paar dir Hoffnung wieder,
Sein Feueratem weht von Land zu Land,
Sprengt deines Kerkers festgetürmte Wand,
Wirft deine Häscher, deine Fesseln nieder.
Scheint mit sich nimmer zu vertragen,
So ist doch ein hohes Wort,
Woran man nur den Widerspruch getadelt;
Doch hat sein Widerspruch manch großen Geist geadelt,
Fürwahr! es starb des letzter Hort,
Wär es gestorben jüngst in unsern Tagen.
Auflösung:[Preßfreiheit]
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
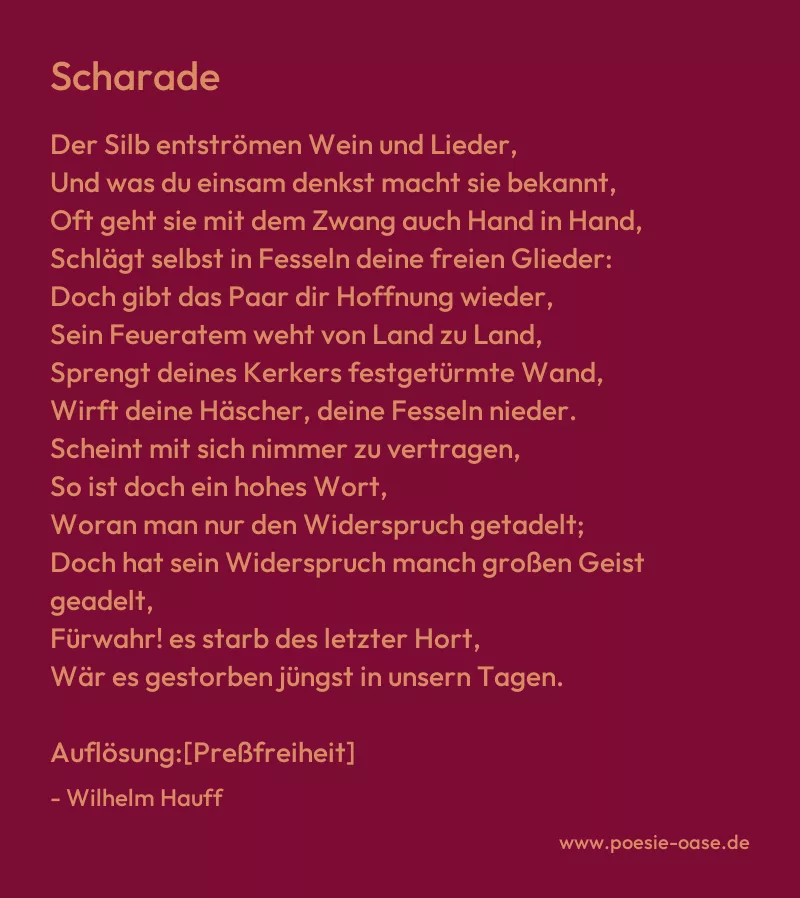
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Scharade“ von Wilhelm Hauff ist ein kunstvolles Rätsel, das sich in Form einer Sonett-Struktur präsentiert. Es wirft Fragen auf, die sich durch die Beschreibung eines Phänomens oder einer Idee in Anspielungen und Paradoxien annähern, bevor die Auflösung am Ende die wahre Identität offenbart. Die gewählte Form des Sonetts, mit ihrem festen Reimschema und dem Wechsel von den ersten acht Versen (Oktave), die das Problem aufwerfen, zu den letzten sechs (Sextett), die die Auflösung andeuten, unterstreicht die intellektuelle Herausforderung des Gedichts.
Die Oktave beschreibt das Rätselobjekt in seinen verschiedenen Eigenschaften. Es erzeugt „Wein und Lieder“, was auf eine Verbindung zur Kreativität und zum gesellschaftlichen Leben hindeutet. Es offenbart die Gedanken des Einzelnen und ermöglicht Kommunikation, kann aber auch Zwang ausüben und die Freiheit beschränken. Die Ambivalenz wird durch die Gegenüberstellung von Freiheitsaspekten (wie der Möglichkeit, die Gedanken des Einzelnen auszudrücken) und Einschränkungen (wie Zwang und Fesseln) deutlich. Diese Widersprüchlichkeit ist ein zentrales Merkmal des Rätsels und deutet auf etwas hin, das sowohl befreiend als auch unterdrückend wirken kann. Die Zeilen „Doch gibt das Paar dir Hoffnung wieder / Sein Feueratem weht von Land zu Land“ deuten auf die Verbreitung und den globalen Einfluss der Lösung hin, was sie zu einer mächtigen Kraft macht.
Das Sextett bietet Hinweise auf die Identität des Rätselobjekts. Die Zeilen „Scheint mit sich nimmer zu vertragen / So ist doch ein hohes Wort“ deuten auf einen Widerspruch in sich selbst, ein Element, das oft zu Konflikten führt, aber auch Innovationen hervorbringen kann. Die Aussage „Doch hat sein Widerspruch manch großen Geist geadelt“ deutet darauf hin, dass das Rätselobjekt in der Lage ist, außergewöhnliche Leistungen zu fördern und bedeutende Figuren zu formen. Der letzte Teil des Gedichts, „Fürwahr! es starb des letzter Hort, / Wär es gestorben jüngst in unsern Tagen.“, liefert einen entscheidenden Hinweis auf die Macht des Rätsels und die Bedeutung seiner Erhaltung. Diese Zeilen unterstreichen die Wichtigkeit und den Wert der Lösung, welche durch die Auflösung zu „Preßfreiheit“ erhalten bleiben soll.
Die Auflösung des Rätsels, „Pressefreiheit“, klärt die beschriebenen Widersprüche und Paradoxien auf. Die Pressefreiheit ermöglicht die Verbreitung von Ideen, sowohl freudige wie auch kritische, sie kann Meinungen offenlegen und Gedanken in die Öffentlichkeit tragen, aber auch Zwang ausüben, indem sie gesellschaftliche Strömungen widerspiegelt und beeinflusst. Sie ist ein mächtiges Werkzeug, das die Freiheit des Einzelnen schützt und fördert, aber auch missbraucht werden kann, was zu Konflikten und Widersprüchen führt. Hauffs Gedicht feiert somit die Pressefreiheit als einen Eckpfeiler der modernen Gesellschaft, der jedoch auch Gefahren birgt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.