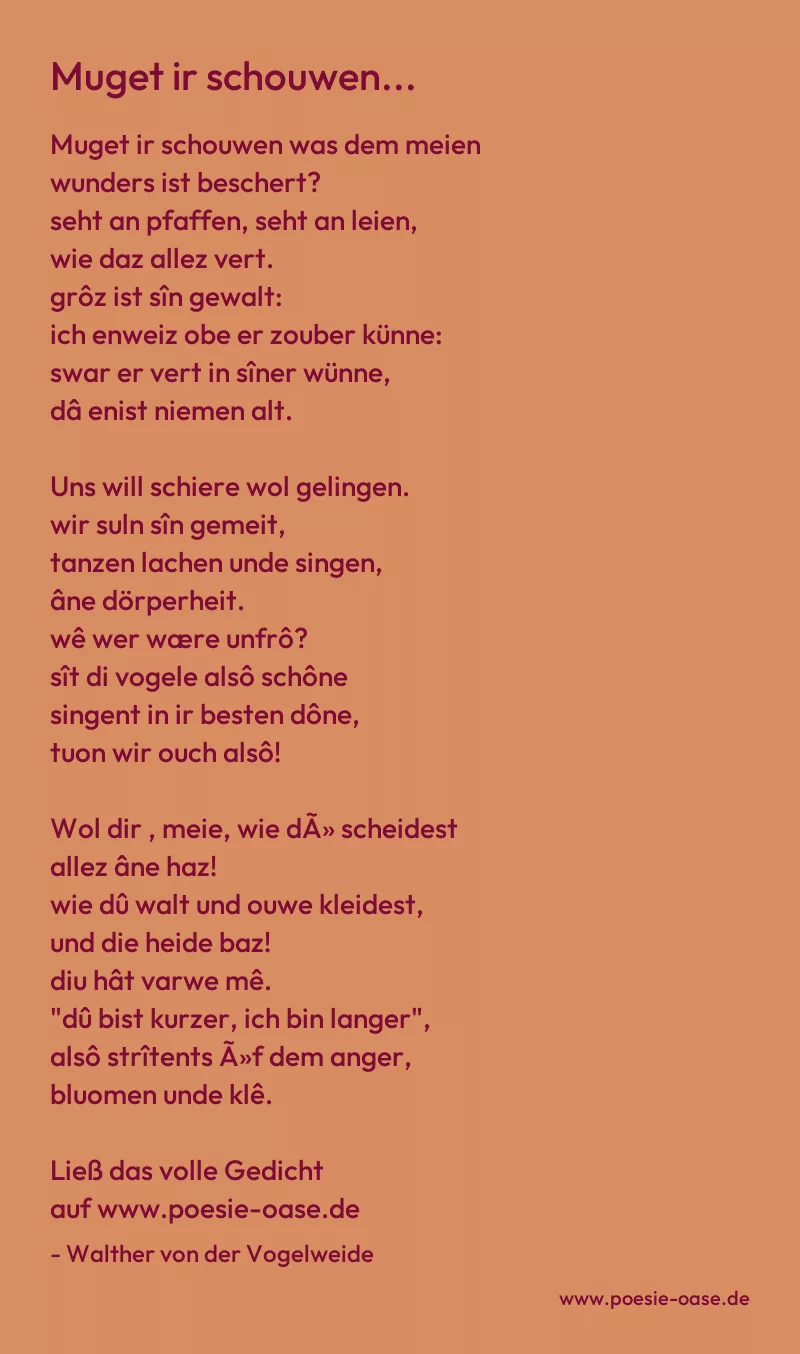Muget ir schouwen…
Muget ir schouwen was dem meien
wunders ist beschert?
seht an pfaffen, seht an leien,
wie daz allez vert.
grôz ist sîn gewalt:
ich enweiz obe er zouber künne:
swar er vert in sîner wünne,
dâ enist niemen alt.
Uns will schiere wol gelingen.
wir suln sîn gemeit,
tanzen lachen unde singen,
âne dörperheit.
wê wer wære unfrô?
sît di vogele alsô schône
singent in ir besten dône,
tuon wir ouch alsô!
Wol dir , meie, wie dû scheidest
allez âne haz!
wie dû walt und ouwe kleidest,
und die heide baz!
diu hât varwe mê.
„dû bist kurzer, ich bin langer“,
alsô strîtents ûf dem anger,
bluomen unde klê.
Rôter munt, wie dû dich swachest!
lâ dîn lachen sîn.
scham dich daz dû mich an lachest
nâch dem schaden mîn.
ist daz wol getân?
owê sô verlorner stunde,
sol von minneclîchem munde
solch unminne ergân!
Daz mich, frouwe, an fröiden irret,
daz ist iuwer lîp.
an iu einer ez mir wirret,
ungenædic wîp.
wâ nemt ir den muot?
ir sît doch genâden rîche:
tuot ir mir ungnædeclîche,
sô sît ir niht guot.
Scheidet, vrouwe, mich von sorgen,
liebet mir die zît:
oder ich muoz an vreuden borgen.
daz ir sælic sît!
muget ir umbe sehen?
sich vreut al diu welt gemeine;
möhte mir von iu ein kleine
vreudelîn geschehen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
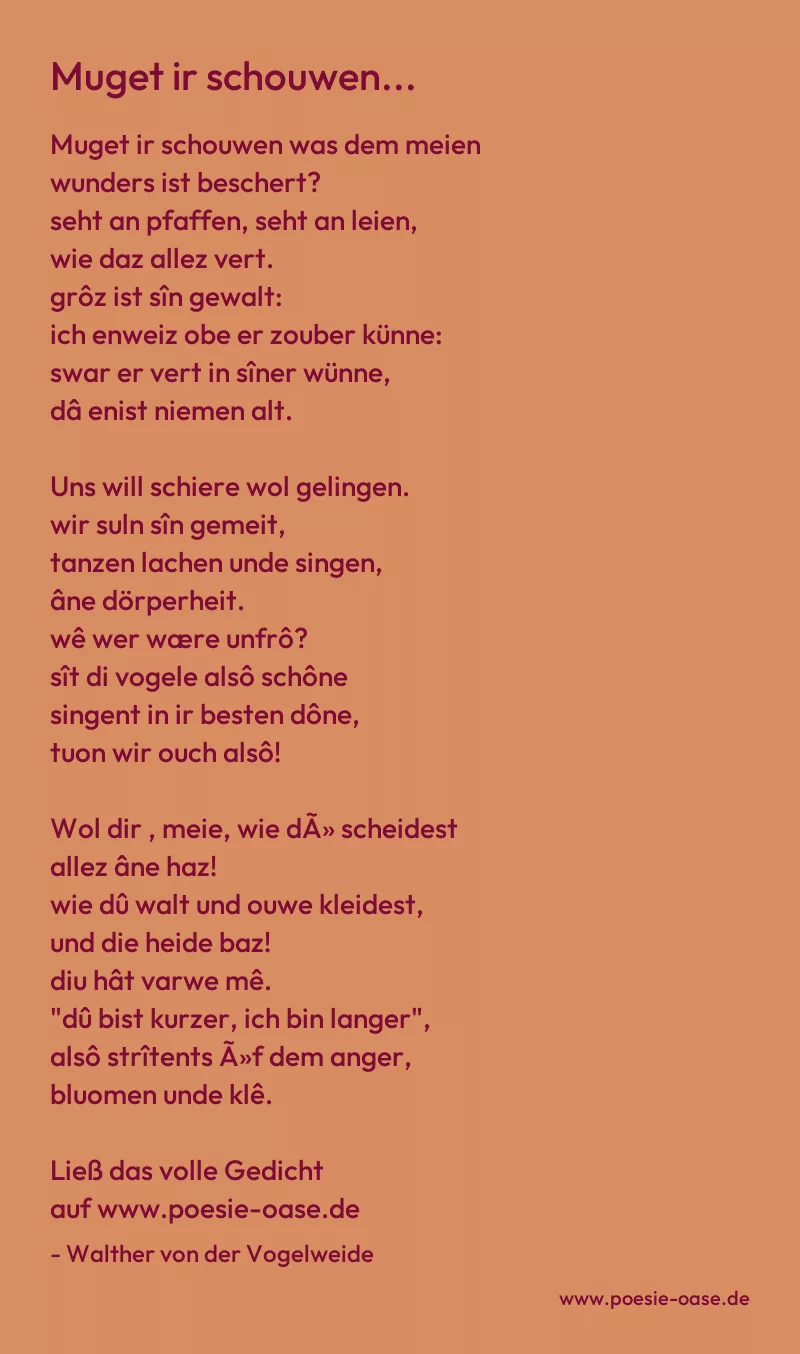
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Muget ir schouwen…“ von Walther von der Vogelweide ist eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Frühling, der Liebe und der Vergänglichkeit, vermischt mit einer persönlichen Klage. Der Dichter nutzt die Natur als Spiegelbild seiner eigenen Gefühle und Situation. Er beginnt mit einer Beobachtung der Natur, der Freude am Erblühen und der scheinbar grenzenlosen Jugendlichkeit, die er mit den Worten „Muget ir schouwen was dem meien wunders ist beschert?“ (Könnt ihr sehen, was dem Mai an Wundern beschert ist?) einleitet. Er sieht die Welt in voller Blüte, aber seine eigene Seele ist getrübt.
Im zweiten Teil wechselt der Fokus zu einer Aufforderung zur Lebensfreude, zum Tanzen, Lachen und Singen, die durch die Vogelwelt inspiriert wird. Der Dichter versucht, sich der allgemeinen Fröhlichkeit anzuschließen, scheitert aber an seinen eigenen inneren Konflikten. Die Zeilen „Uns will schiere wol gelingen. wir suln sîn gemeit, tanzen lachen unde singen, âne dörperheit.“ (Uns soll es bald gut ergehen. Wir sollen uns fröhlich zeigen, tanzen, lachen und singen, ohne Tölpelhaftigkeit) lassen den Versuch erkennen, die Freude zu simulieren, die er in der Natur wahrnimmt. Der Kontrast zwischen der äußeren Welt, die von Glück und Schönheit strotzt, und der inneren Welt des Dichters, die von Trauer und unerfüllter Liebe geprägt ist, wird hier deutlich.
Die folgenden Strophen wenden sich direkt an eine unerreichbare Frau, die „frouwe“. Die Anklage, die darin zum Ausdruck kommt, ist von Sehnsucht, Enttäuschung und Verzweiflung geprägt. Er beklagt ihr Verhalten, das ihn traurig macht und ihn von der Freude ausschließt, die er in der Natur wahrnimmt. Der Dichter wirft ihr vor, ihm Ungnade zu erweisen und ihn damit am Glück zu hindern. Die Zeilen „Daz mich, frouwe, an fröiden irret, daz ist iuwer lîp.“ (Dass mich, Dame, die Freude verlässt, das ist eure Schuld) zeigen seinen Schmerz und die tiefe Verletzung, die er durch ihre Ablehnung erfährt.
Die letzten Verse sind ein Appell an die Frau, ihn von seinen Sorgen zu befreien und ihm die ersehnte Liebe zu gewähren. Er bittet sie, ihn glücklich zu machen und ihm die Freude zu schenken, die er so sehr sucht. Das Gedicht endet mit einem hoffnungsvollen Blick, indem er sie anfleht, ihm „ein kleine vreudelîn“ (ein wenig Freude) zu schenken. Walther von der Vogelweide schafft es, die tiefe Melancholie und die Sehnsucht nach Liebe, eingebettet in die wunderschönen Bilder des Frühlings, zu vereinen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.