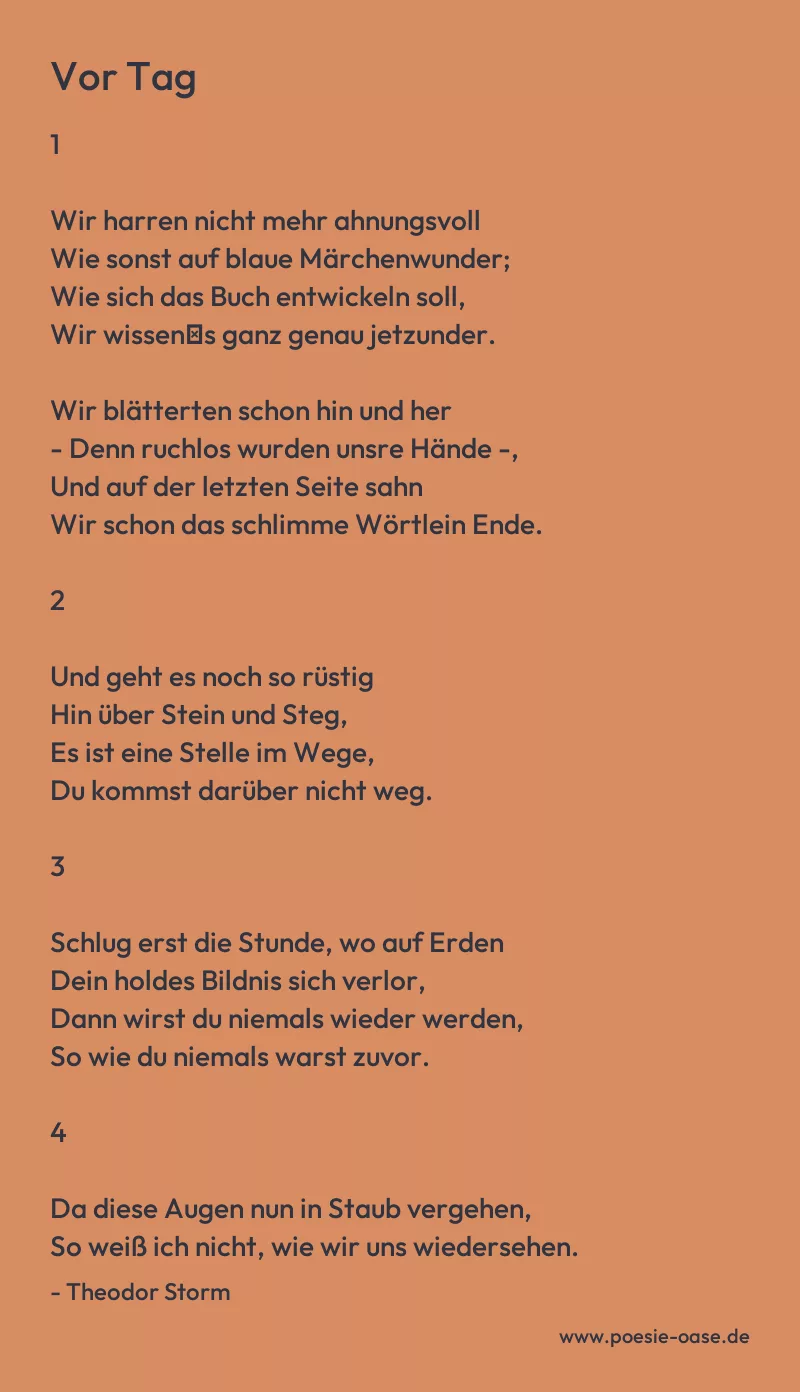Vor Tag
1
Wir harren nicht mehr ahnungsvoll
Wie sonst auf blaue Märchenwunder;
Wie sich das Buch entwickeln soll,
Wir wissen′s ganz genau jetzunder.
Wir blätterten schon hin und her
– Denn ruchlos wurden unsre Hände -,
Und auf der letzten Seite sahn
Wir schon das schlimme Wörtlein Ende.
2
Und geht es noch so rüstig
Hin über Stein und Steg,
Es ist eine Stelle im Wege,
Du kommst darüber nicht weg.
3
Schlug erst die Stunde, wo auf Erden
Dein holdes Bildnis sich verlor,
Dann wirst du niemals wieder werden,
So wie du niemals warst zuvor.
4
Da diese Augen nun in Staub vergehen,
So weiß ich nicht, wie wir uns wiedersehen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
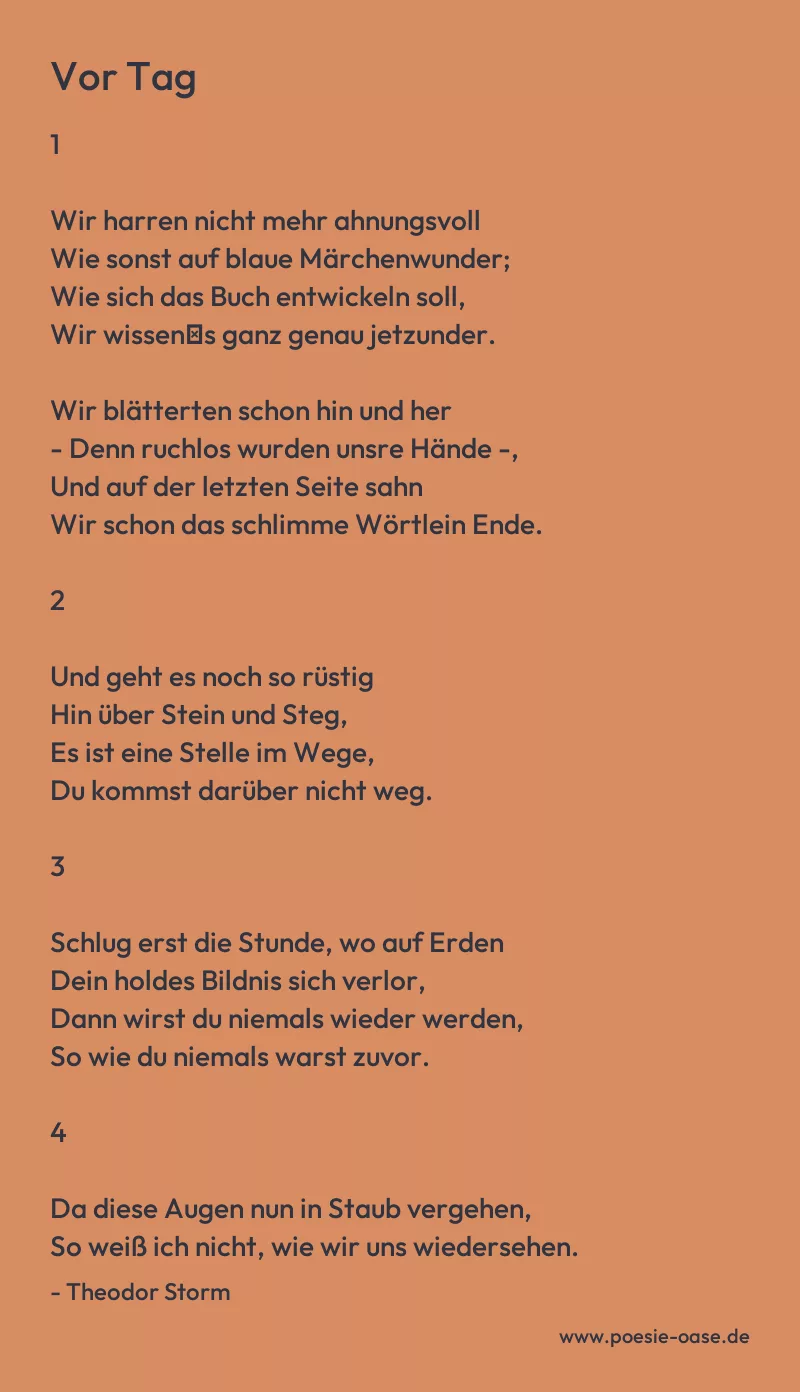
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vor Tag“ von Theodor Storm ist eine melancholische Reflexion über die Endlichkeit des Lebens, die Illusion von Freiheit und die unausweichliche Akzeptanz des Todes. Das Gedicht unterteilt sich in vier Teile, die jeweils unterschiedliche Aspekte dieser Thematik beleuchten. Es handelt sich um eine Betrachtung des Lebensweges, der durch Erfahrung und Wissen geprägt ist, und der letztendlich in der Gewissheit des Endes mündet.
Der erste Teil drückt die Ernüchterung aus, die durch das Wissen um das Lebensende entsteht. Die anfängliche Unschuld, das Hoffen auf „blaue Märchenwunder“, ist verflogen. Durch die „ruchlosen Hände“ der Erfahrung, also durch das Lesen und Verstehen des Lebens, hat man die „letzte Seite“ erreicht, auf der das „schlimme Wörtlein Ende“ steht. Die Metapher des Buches steht für das Leben selbst, das man bis zum Ende durchblättert und dessen Ausgang man kennt. Dies deutet auf eine tiefe Einsicht und die Erkenntnis hin, dass das Leben nicht mehr von unbegrenzter Hoffnung getragen wird, sondern von der Gewissheit des Todes überschattet ist.
Der zweite Teil verstärkt diese resignierte Haltung. Unabhängig von der vermeintlichen Stärke und dem Fortschritt, symbolisiert durch „Stein und Steg“, gibt es einen Punkt, an dem man scheitern muss, eine „Stelle im Wege“, über die man nicht hinwegkommt. Dies ist eine klare Anspielung auf die Unvermeidbarkeit des Todes, der als unüberwindbare Barriere dargestellt wird. Die Zeilen betonen die Begrenztheit des menschlichen Handelns und die Ohnmacht gegenüber dem Schicksal.
Der dritte Teil greift die Thematik des Verlustes auf und verbindet diesen mit der Unwiederbringlichkeit. Das „holdes Bildnis“, die geliebte Person oder das Ideal, das man verloren hat, kann nicht zurückgewonnen werden. Die Zeilen betonen die Unumkehrbarkeit der Zeit und die Vergänglichkeit des Lebens. Das lyrische Ich scheint die Akzeptanz des Todes und der damit verbundenen Abschiednahme auszudrücken.
Im letzten Teil wird die direkte Konfrontation mit der Vergänglichkeit durch die Metapher des „in Staub vergehen“ ausgedrückt. Die Frage nach dem „Wiedersehen“ deutet auf eine Auseinandersetzung mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod oder die Hoffnung auf ein Wiedersehen nach dem Tod hin. Die Unsicherheit in dieser Frage verdeutlicht die tiefe Verunsicherung und die existenzielle Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Schicksal des Menschen nach dem Tod. Das Gedicht ist somit ein Ausdruck der Trauer über die Endlichkeit und des tiefen Zweifels an der Möglichkeit, die geliebten Menschen nach dem Tod wiederzusehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.