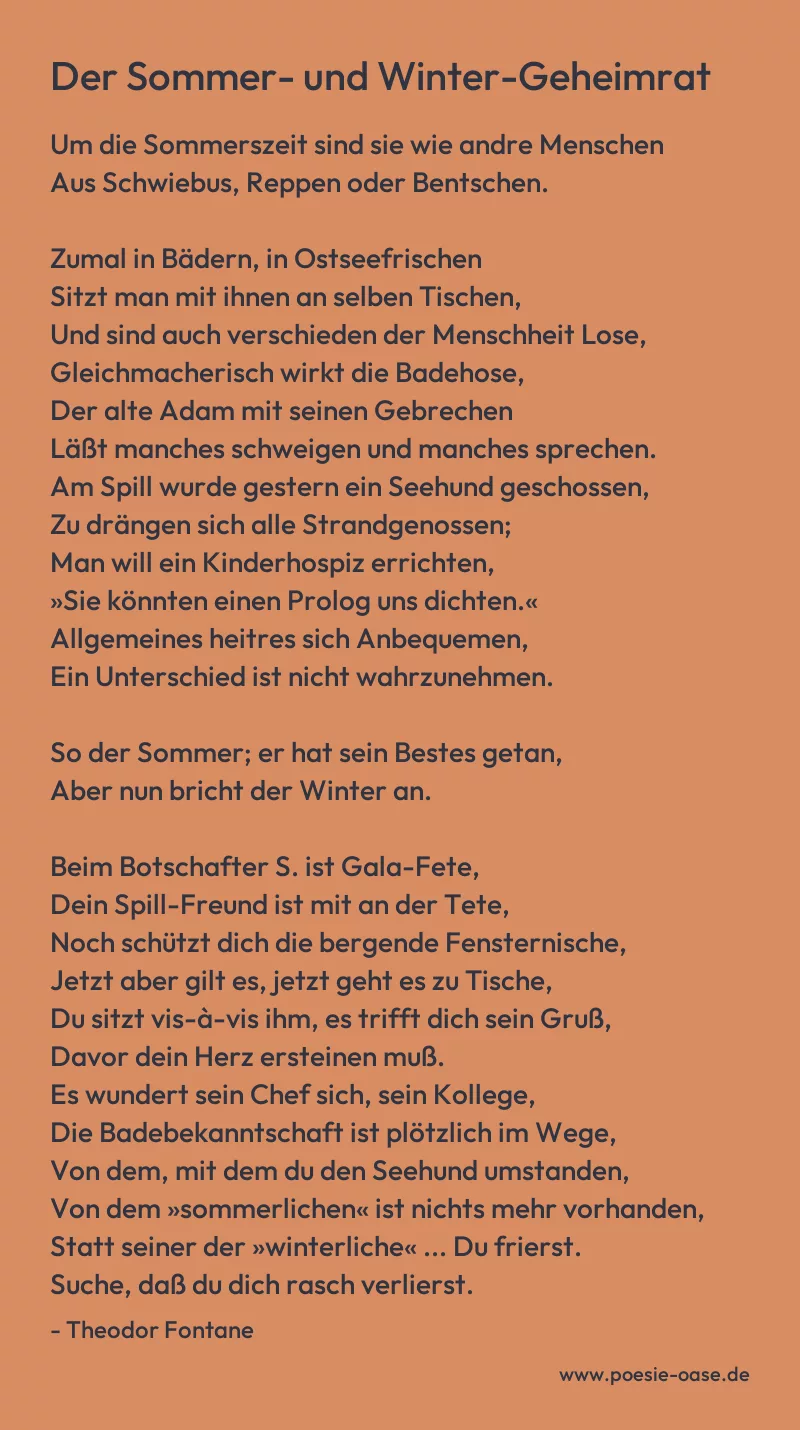Der Sommer- und Winter-Geheimrat
Um die Sommerszeit sind sie wie andre Menschen
Aus Schwiebus, Reppen oder Bentschen.
Zumal in Bädern, in Ostseefrischen
Sitzt man mit ihnen an selben Tischen,
Und sind auch verschieden der Menschheit Lose,
Gleichmacherisch wirkt die Badehose,
Der alte Adam mit seinen Gebrechen
Läßt manches schweigen und manches sprechen.
Am Spill wurde gestern ein Seehund geschossen,
Zu drängen sich alle Strandgenossen;
Man will ein Kinderhospiz errichten,
»Sie könnten einen Prolog uns dichten.«
Allgemeines heitres sich Anbequemen,
Ein Unterschied ist nicht wahrzunehmen.
So der Sommer; er hat sein Bestes getan,
Aber nun bricht der Winter an.
Beim Botschafter S. ist Gala-Fete,
Dein Spill-Freund ist mit an der Tete,
Noch schützt dich die bergende Fensternische,
Jetzt aber gilt es, jetzt geht es zu Tische,
Du sitzt vis-à-vis ihm, es trifft dich sein Gruß,
Davor dein Herz ersteinen muß.
Es wundert sein Chef sich, sein Kollege,
Die Badebekanntschaft ist plötzlich im Wege,
Von dem, mit dem du den Seehund umstanden,
Von dem »sommerlichen« ist nichts mehr vorhanden,
Statt seiner der »winterliche« … Du frierst.
Suche, daß du dich rasch verlierst.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
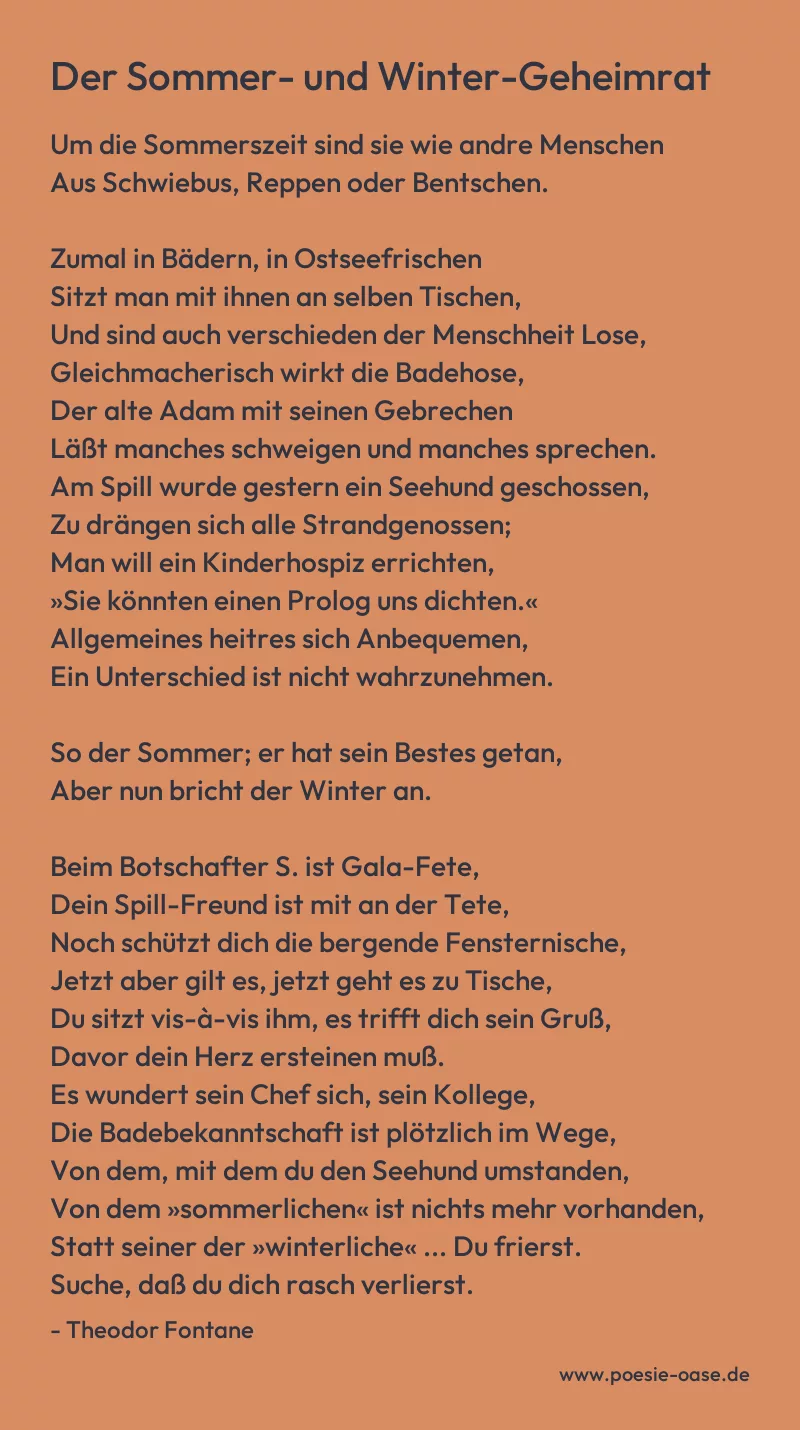
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sommer- und Winter-Geheimrat“ von Theodor Fontane ist eine satirische Beobachtung über die Verstellung und das gesellschaftliche Verhalten des Bürgertums. Das Gedicht entlarvt die Heuchelei und den Klassendünkel, indem es den Kontrast zwischen der vermeintlichen Gleichheit im Sommer und der kalten, hierarchischen Ordnung im Winter aufzeigt. Fontane verwendet eine humorvolle, aber dennoch bissige Sprache, um die Doppelmoral und die soziale Distanz innerhalb der feinen Gesellschaft zu kritisieren.
Die erste Hälfte des Gedichts beschreibt die sommerliche Idylle, in der die Grenzen zwischen den Menschen verschwimmen. In Badeorten an der Ostsee sitzen alle an den gleichen Tischen, tragen Badehosen, und sogar der alte Adam, also die menschliche Natur, scheint alle gleich zu machen. Gemeinsame Erlebnisse wie die Beobachtung eines erschossenen Seehunds oder die Idee eines Kinderhospizes schaffen eine Atmosphäre der Gemeinschaft und des zwanglosen Umgangs. Diese vermeintliche Nähe und das gemeinsame Interesse an belanglosen Dingen dienen als Fassade für die wahre soziale Ungleichheit. Der „Sommer-Geheimrat“ ist hier noch ein Mensch unter Menschen, unauffällig und Teil des Ganzen.
Der Übergang zum Winter markiert einen radikalen Wandel. Mit dem Besuch einer Gala-Fete beim Botschafter S. und dem damit einhergehenden gesellschaftlichen Zwang, offenbart sich die wahre Natur der sozialen Beziehungen. Die sommerliche Freundschaft verwandelt sich in kalte Distanz und hierarchische Unterordnung. Der Geheimrat, der im Sommer noch ein „Strandgenosse“ war, verwandelt sich in eine distanzierte, winterliche Figur, die den Ich-Erzähler mit einem kalten Gruß empfängt und ihn in Verlegenheit bringt. Die „Badebekanntschaft“ wird zur Belastung, und die soziale Maske des Geheimrats entlarvt die wahre, elitäre Gesinnung. Der Ich-Erzähler wird gezwungen, sich zurückzuziehen und zu verschwinden, weil er die gesellschaftlichen Regeln nicht erfüllen kann.
Fontanes Gedicht ist eine meisterhafte Satire, die durch den Kontrast zwischen Sommer und Winter die Heuchelei und die soziale Ungleichheit der Gesellschaft kritisiert. Die einfachen, volkstümlichen Verse und die ironische Sprache machen die Botschaft für den Leser unmittelbar verständlich. Der „Sommer-Geheimrat“ steht für die Maske der Freundlichkeit und Gleichheit, während der „Winter-Geheimrat“ die kalte, berechnende Seite der Gesellschaft repräsentiert, die ihre Beziehungen nach Macht und Status ausrichtet. Die letzte Zeile, „Suche, daß du dich rasch verlierst“, ist ein bitterer Kommentar zur Notwendigkeit der Anpassung an die herrschenden gesellschaftlichen Konventionen oder der drohenden Ausgrenzung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.