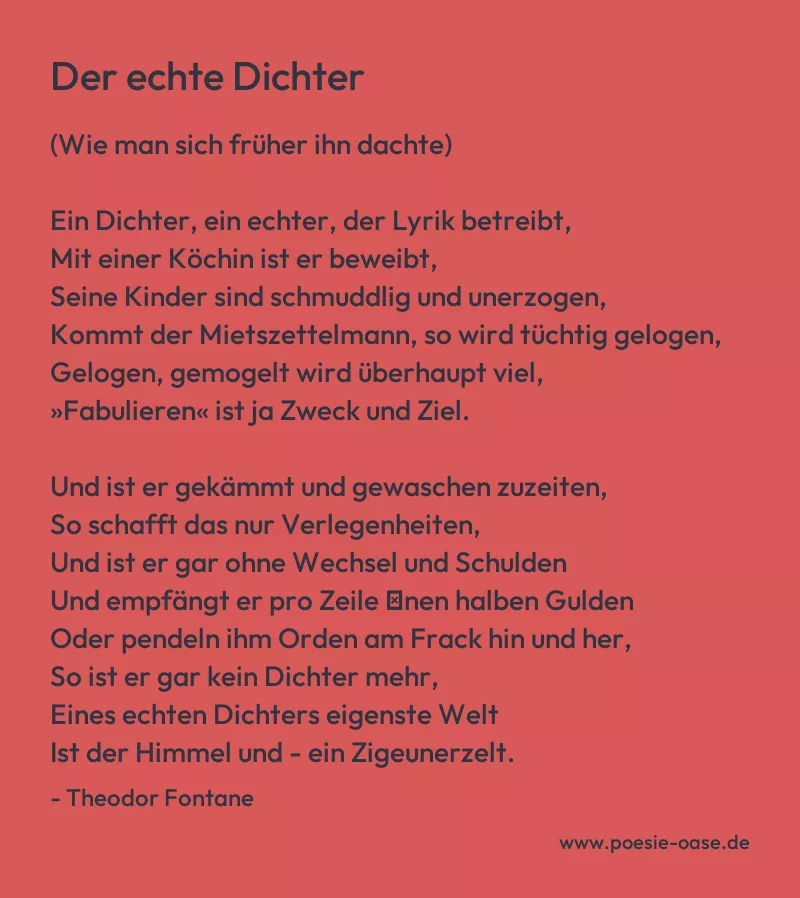Der echte Dichter
(Wie man sich früher ihn dachte)
Ein Dichter, ein echter, der Lyrik betreibt,
Mit einer Köchin ist er beweibt,
Seine Kinder sind schmuddlig und unerzogen,
Kommt der Mietszettelmann, so wird tüchtig gelogen,
Gelogen, gemogelt wird überhaupt viel,
»Fabulieren« ist ja Zweck und Ziel.
Und ist er gekämmt und gewaschen zuzeiten,
So schafft das nur Verlegenheiten,
Und ist er gar ohne Wechsel und Schulden
Und empfängt er pro Zeile ′nen halben Gulden
Oder pendeln ihm Orden am Frack hin und her,
So ist er gar kein Dichter mehr,
Eines echten Dichters eigenste Welt
Ist der Himmel und – ein Zigeunerzelt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
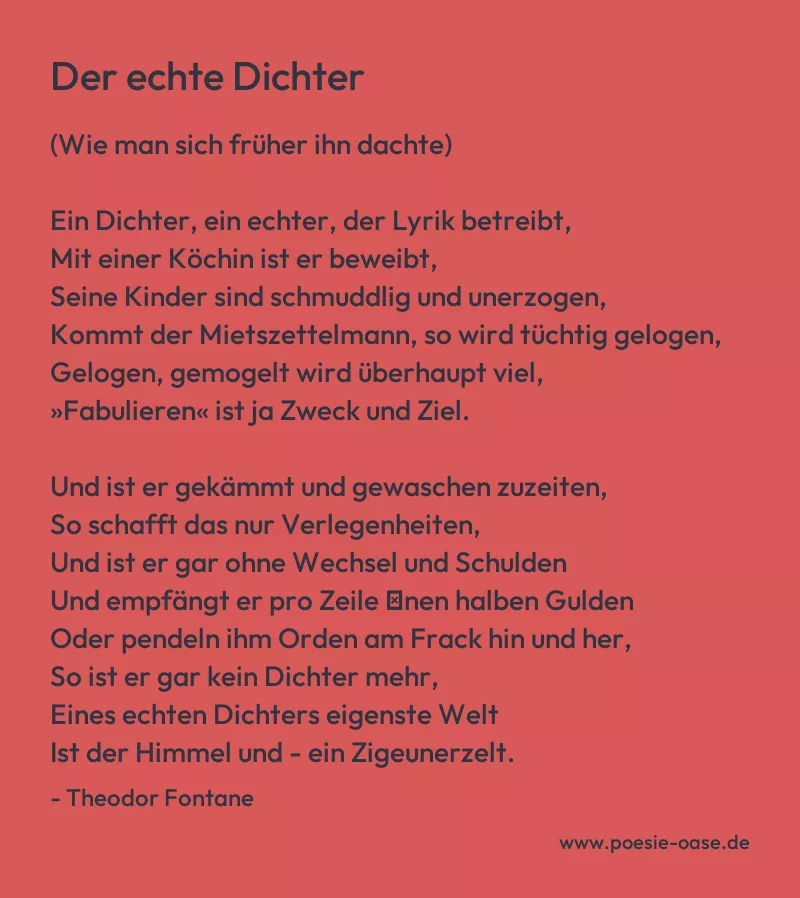
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der echte Dichter“ von Theodor Fontane karikiert auf humorvolle Weise das traditionelle Bild eines Dichters und stellt es in Frage, indem es eine ironische Gegenüberstellung von Ideal und Realität vornimmt. Das Gedicht greift das klischeehafte Bild des Dichters auf, der in Armut, Unordnung und einem Leben fernab bürgerlicher Konventionen existiert.
Fontane beginnt mit der Feststellung, dass ein wahrer Dichter mit einer Köchin verheiratet ist, was sofort eine Diskrepanz zum romantischen Bild des Dichters als idealisiertem Liebhaber und Seelenverwandten aufbaut. Seine Kinder sind „schmuddlig und unerzogen“, was das Chaos und die Unkonventionalität des Dichters zusätzlich unterstreicht. Auch der Umgang mit finanziellen Verpflichtungen, das „tüchtige Lügen“ beim Mietszettelmann, passt nicht zum gesellschaftlichen Ideal. Der Verweis auf das „Fabulieren“ als „Zweck und Ziel“ deutet darauf hin, dass das Dichten, das Schaffen von Geschichten und Fantasien, über allen anderen Lebensbereichen steht.
Die zweite Hälfte des Gedichts kehrt das Bild des „echten“ Dichters um. Der Dichter, der sich kämmt, wäscht und ohne Schulden lebt, sowie Orden trägt, ist „gar kein Dichter mehr“. Hier wird die Vorstellung von materieller Sicherheit und gesellschaftlicher Anerkennung als Hindernis für die wahre Dichterexistenz dargestellt. Der wahre Dichter, so die Botschaft, findet seine Welt im „Himmel“ und im „Zigeunerzelt“, also in der Freiheit, der Ungebundenheit und der Suche nach dem Außergewöhnlichen. Die Ironie liegt darin, dass die traditionellen Vorstellungen von Reinheit, Ordnung und finanzieller Sicherheit als unvereinbar mit dem Wesen eines echten Dichters dargestellt werden.
Fontane kritisiert mit dieser Karikatur nicht nur das romantische Ideal des Dichters, sondern auch die Engstirnigkeit der Gesellschaft, die den Dichter auf bestimmte Rollen und Lebensweisen festlegt. Das Gedicht ist somit eine subtile Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen Kunst, Leben und gesellschaftlichen Erwartungen. Fontane hinterfragt, was einen Dichter wirklich ausmacht, und deutet an, dass wahre Kunst oft aus dem Abseits, aus der Unangepasstheit und der Freiheit des Geistes entspringt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.