Ich bin der Eine und bin Beide
Ich bin der zeuger bin der schooss
Ich bin der degen und die scheide
Ich bin das opfer bin der stoss
Ich bin die sicht und bin der seher
Ich bin der bogen bin der bolz
Ich bin der altar und der fleher
Ich bin das feuer und das holz
Ich bin der reiche und bin der bare
Ich bin das zeichen bin der sinn
Ich bin der schatten bin der wahre
Ich bin ein end und ein beginn.
Ich bin der Eine und bin Beide
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
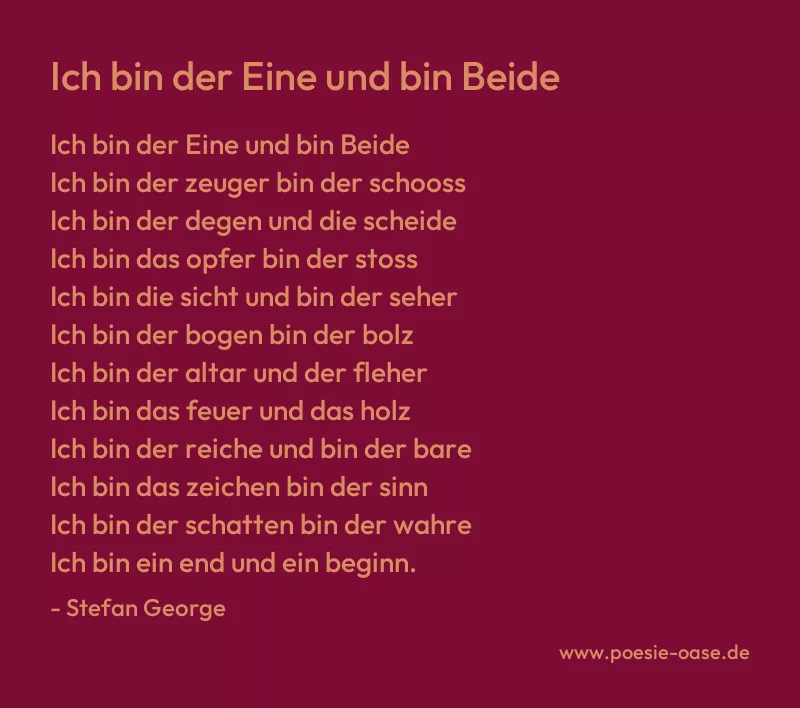
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich bin der Eine und bin Beide“ von Stefan George ist eine eindringliche Selbstbehauptung, die von einer Person ausgeht, die sich als Inbegriff aller Gegensätze und Extreme darstellt. Durch die wiederholte Verwendung des „Ich bin“ wird eine dominante, allgegenwärtige Stimme etabliert, die sowohl schöpferisch als auch zerstörerisch, sowohl aktiv als auch passiv ist. Diese dualistische Struktur deutet auf eine umfassende Erfahrung der Existenz hin, in der Gegensätze nicht als Widersprüche, sondern als untrennbare Bestandteile eines Ganzen gesehen werden.
Die zentrale Bedeutung des Gedichts liegt in der Auflösung scheinbarer Gegensätze. Der Sprecher identifiziert sich sowohl mit dem „Zeuger“ als auch mit dem „Schooss“, mit dem „Degen“ und der „Scheide“, mit dem „Opfer“ und dem „Stoss“. Diese Gegenüberstellungen lassen den Eindruck entstehen, dass der Sprecher sowohl die aktive als auch die passive Rolle in allen Lebensbereichen ausfüllt. Er ist sowohl Schöpfer als auch Empfänger, sowohl Angreifer als auch Verteidiger. Diese Verschmelzung von Gegensätzen suggeriert eine Art von Vollkommenheit, in der alle Aspekte des Daseins in Einklang gebracht werden.
Darüber hinaus offenbart das Gedicht eine spirituelle Dimension. Der Sprecher ist nicht nur physisch aktiv, sondern auch geistig präsent. Er ist „der Seher“ und „die Sicht“, „der Bogen“ und „der Bolz“, was auf eine allumfassende Wahrnehmung und ein tiefes Verständnis der Welt hinweist. Das Gedicht berührt auch religiöse Motive, indem es den „Altar“ und den „Fleher“, „das Feuer“ und „das Holz“ vereint. Hier deutet sich die Auflösung von Dualitäten in einem transzendenten Zustand an. Der Sprecher vereint auch das Endliche und das Unendliche, indem er sowohl „das Ende“ als auch „den Beginn“ repräsentiert.
Die formale Gestaltung des Gedichts, insbesondere die konsequente Verwendung von Reimen und die präzise Wortwahl, verstärkt die Botschaft der Einheit und des Gleichgewichts. Die klaren, prägnanten Aussagen und die rhythmische Struktur erzeugen einen Sog, der den Leser in die Welt des Sprechers hineinzieht. Durch diese sprachliche Gestaltung wird die Vorstellung von einer umfassenden, allumfassenden Identität vermittelt, die über die Grenzen des Individuums hinausgeht und eine universelle Gültigkeit beansprucht. Das Gedicht ist somit ein eindringliches Manifest der Selbstfindung und ein Lobgesang auf die Einheit von Gegensätzen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
