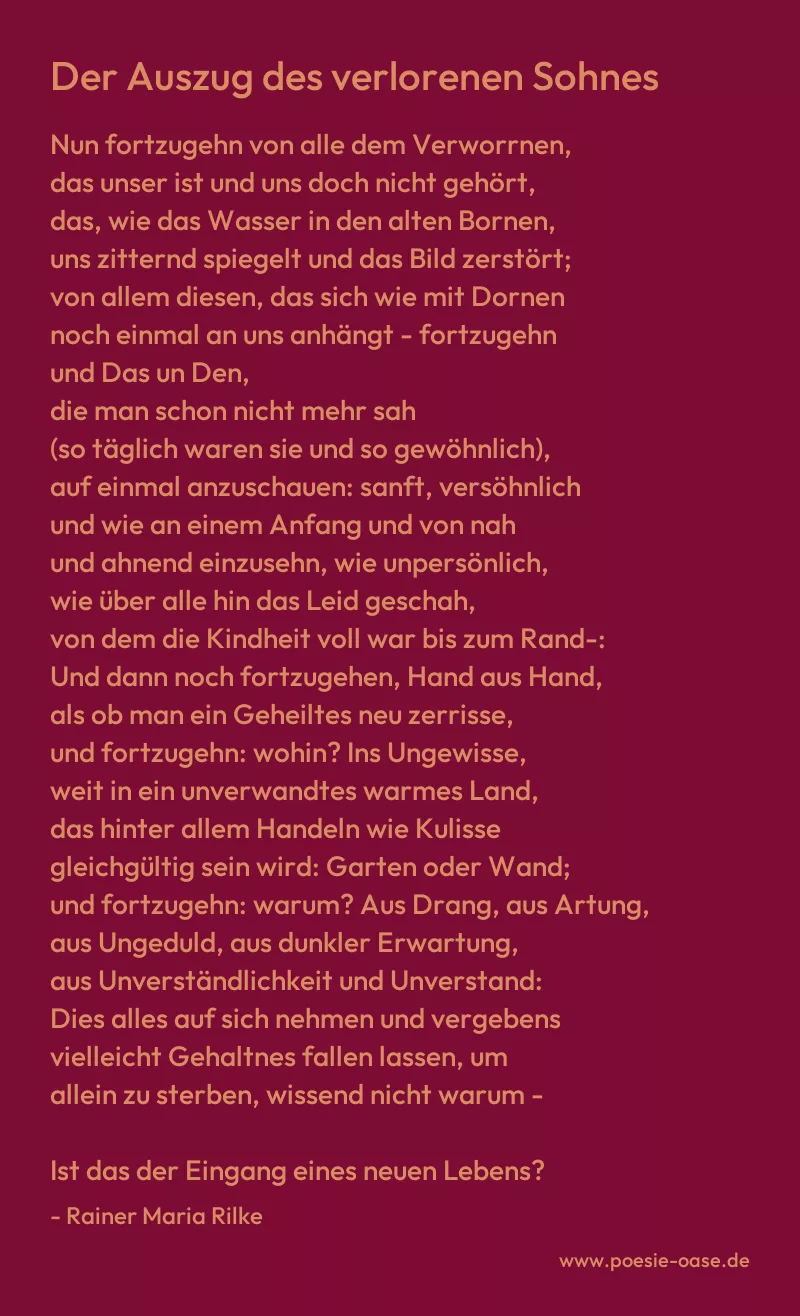Der Auszug des verlorenen Sohnes
Nun fortzugehn von alle dem Verworrnen,
das unser ist und uns doch nicht gehört,
das, wie das Wasser in den alten Bornen,
uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört;
von allem diesen, das sich wie mit Dornen
noch einmal an uns anhängt – fortzugehn
und Das un Den,
die man schon nicht mehr sah
(so täglich waren sie und so gewöhnlich),
auf einmal anzuschauen: sanft, versöhnlich
und wie an einem Anfang und von nah
und ahnend einzusehn, wie unpersönlich,
wie über alle hin das Leid geschah,
von dem die Kindheit voll war bis zum Rand-:
Und dann noch fortzugehen, Hand aus Hand,
als ob man ein Geheiltes neu zerrisse,
und fortzugehn: wohin? Ins Ungewisse,
weit in ein unverwandtes warmes Land,
das hinter allem Handeln wie Kulisse
gleichgültig sein wird: Garten oder Wand;
und fortzugehn: warum? Aus Drang, aus Artung,
aus Ungeduld, aus dunkler Erwartung,
aus Unverständlichkeit und Unverstand:
Dies alles auf sich nehmen und vergebens
vielleicht Gehaltnes fallen lassen, um
allein zu sterben, wissend nicht warum –
Ist das der Eingang eines neuen Lebens?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
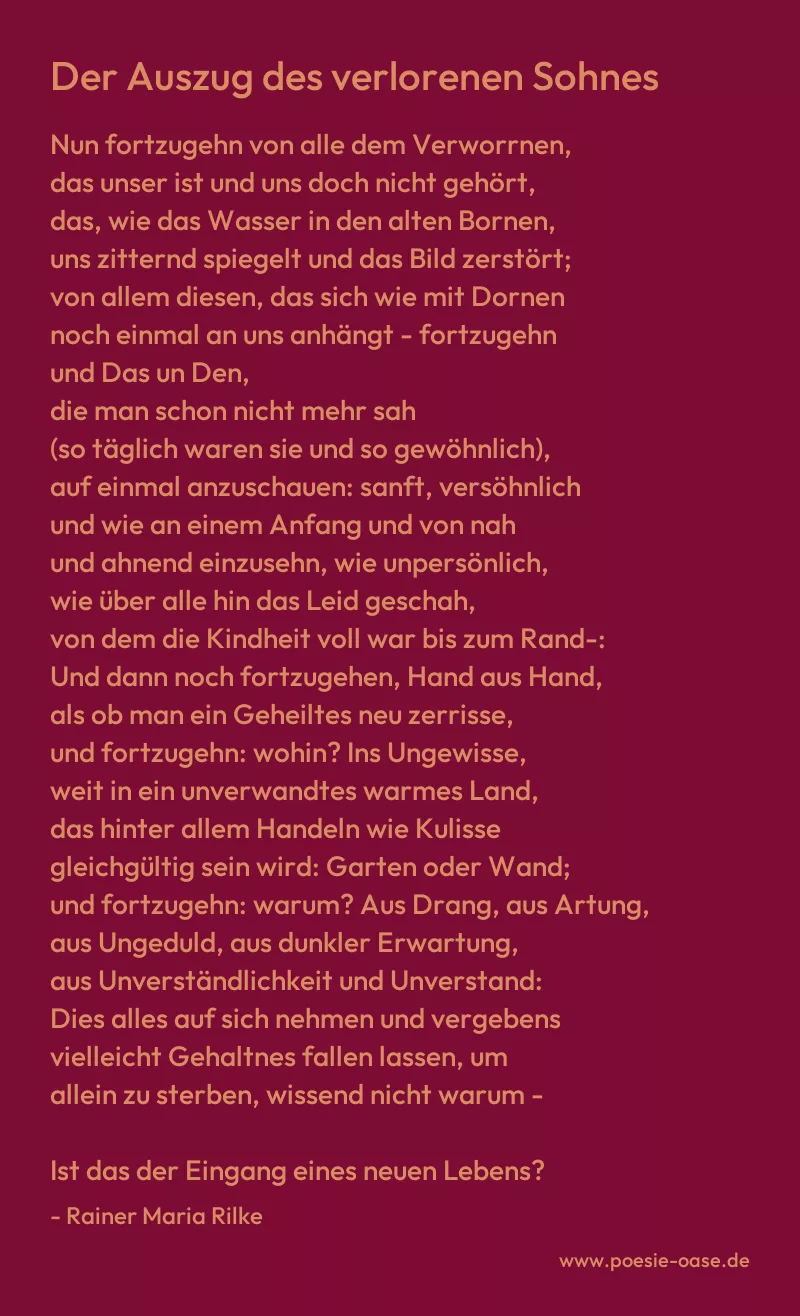
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Auszug des verlorenen Sohnes“ von Rainer Maria Rilke beschreibt in eindringlichen Bildern den Prozess der Loslösung und des Aufbruchs, der von einer inneren Zerrissenheit und der Suche nach einem neuen Anfang geprägt ist. Der Titel verweist auf die biblische Erzählung vom verlorenen Sohn, deutet aber gleichzeitig eine Abkehr vom Vertrauten und eine Suche nach dem Unbekannten an. Das Gedicht erkundet die Motive des Abschieds, der Entfremdung und der Sehnsucht nach etwas Neuem, das sich in der Unbestimmtheit des Ziels ausdrückt.
Rilke beginnt mit dem Abschied von einer Welt, die als „verworren“ und entfremdet charakterisiert wird, von etwas, das dem lyrischen Ich zwar gehört, es aber dennoch nicht ganz umfasst. Die Metapher des „Wassers in den alten Bornen“ unterstreicht die Unbeständigkeit und Zerstörung des eigenen Bildes im Vertrauten. Die „Dornen“, die sich an das lyrische Ich klammern, symbolisieren die Bindungen und die Vergangenheit, die es zu verlassen gilt. Das Gedicht beschreibt dann eine Phase des Innehaltens und der Rückschau, bevor der endgültige Schritt in die Ungewissheit erfolgt. Die „sanften“ und „versöhnlichen“ „Den“, die zuvor als alltäglich wahrgenommen wurden, erscheinen jetzt in einem neuen Licht, vielleicht als eine Art Abschiedsgruss.
Die eigentliche Reise, der „Auszug“, ist von einer Vielzahl von Gründen getrieben, die paradoxerweise sowohl im konkreten als auch im abstrakten Bereich liegen. „Drang“, „Artung“ und „Unerwartung“ weisen auf eine innere Notwendigkeit hin, während „Unverständlichkeit“ und „Unverstand“ die rationale Begründung in Frage stellen. Die Ungewissheit des Ziels wird betont: „Ins Ungewisse“, „ein unverwandtes warmes Land“. Die Landschaft spielt dabei keine Rolle, da sie „gleichgültig sein wird“. Das bedeutet, dass die Reise selbst wichtiger ist als der Ort. Das lyrische Ich scheint bereit, alles zu riskieren, sogar das scheinbar Wertvolle „vergebens“ fallen zu lassen und vielleicht „allein zu sterben, wissend nicht warum“.
Die abschliessende Frage „Ist das der Eingang eines neuen Lebens?“ deutet auf die ambivalente Natur des Aufbruchs hin. Es ist ein Schritt in die Ungewissheit, in die Leere, aber gleichzeitig die mögliche Geburt eines neuen Lebens. Der Tod wird hier nicht unbedingt als physisches Sterben verstanden, sondern als ein Loslassen, ein Abschied von der Vergangenheit, von Gewohnheiten und dem Gefühl der Sicherheit. Das Gedicht lässt offen, ob dieser Auszug zu einem wirklichen Neubeginn führt, aber es deutet an, dass die Bereitschaft, sich auf das Unbekannte einzulassen, der erste Schritt dazu sein könnte. Es ist ein Gedicht über die existenzielle Suche nach Sinn und dem Mut, sich von den Fesseln der Vergangenheit zu befreien.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.