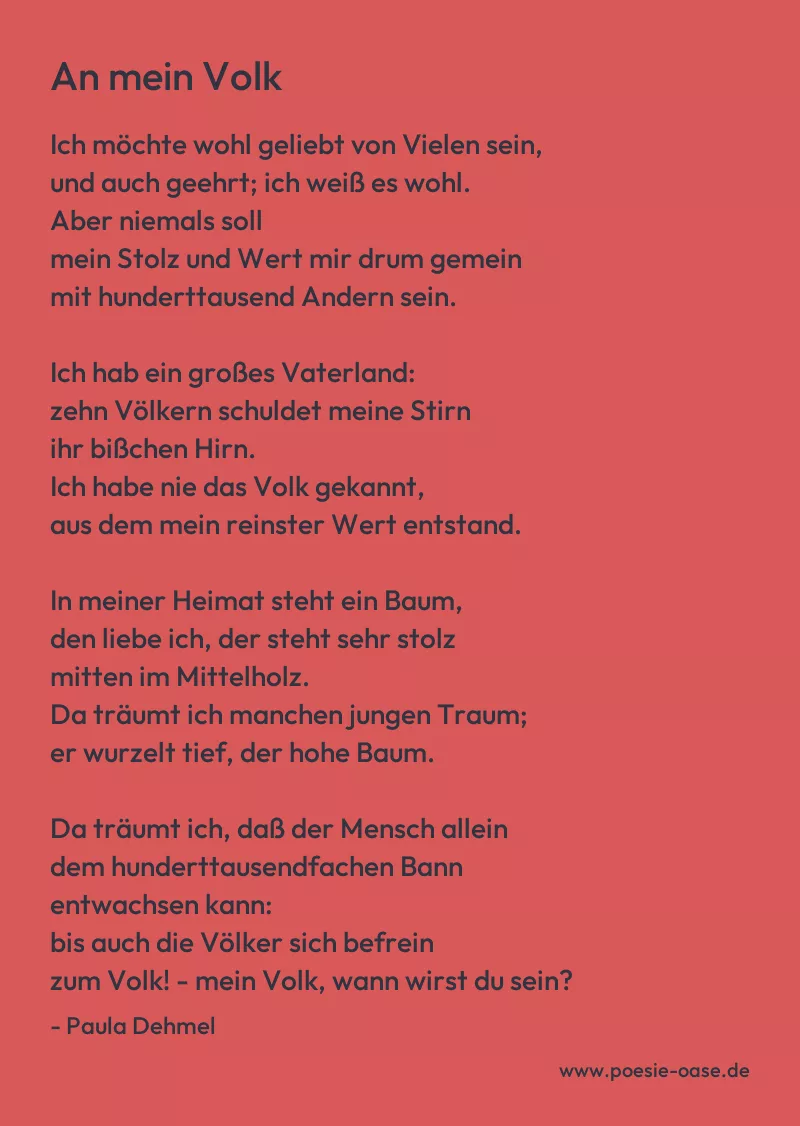An mein Volk
Ich möchte wohl geliebt von Vielen sein,
und auch geehrt; ich weiß es wohl.
Aber niemals soll
mein Stolz und Wert mir drum gemein
mit hunderttausend Andern sein.
Ich hab ein großes Vaterland:
zehn Völkern schuldet meine Stirn
ihr bißchen Hirn.
Ich habe nie das Volk gekannt,
aus dem mein reinster Wert entstand.
In meiner Heimat steht ein Baum,
den liebe ich, der steht sehr stolz
mitten im Mittelholz.
Da träumt ich manchen jungen Traum;
er wurzelt tief, der hohe Baum.
Da träumt ich, daß der Mensch allein
dem hunderttausendfachen Bann
entwachsen kann:
bis auch die Völker sich befrein
zum Volk! – mein Volk, wann wirst du sein?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
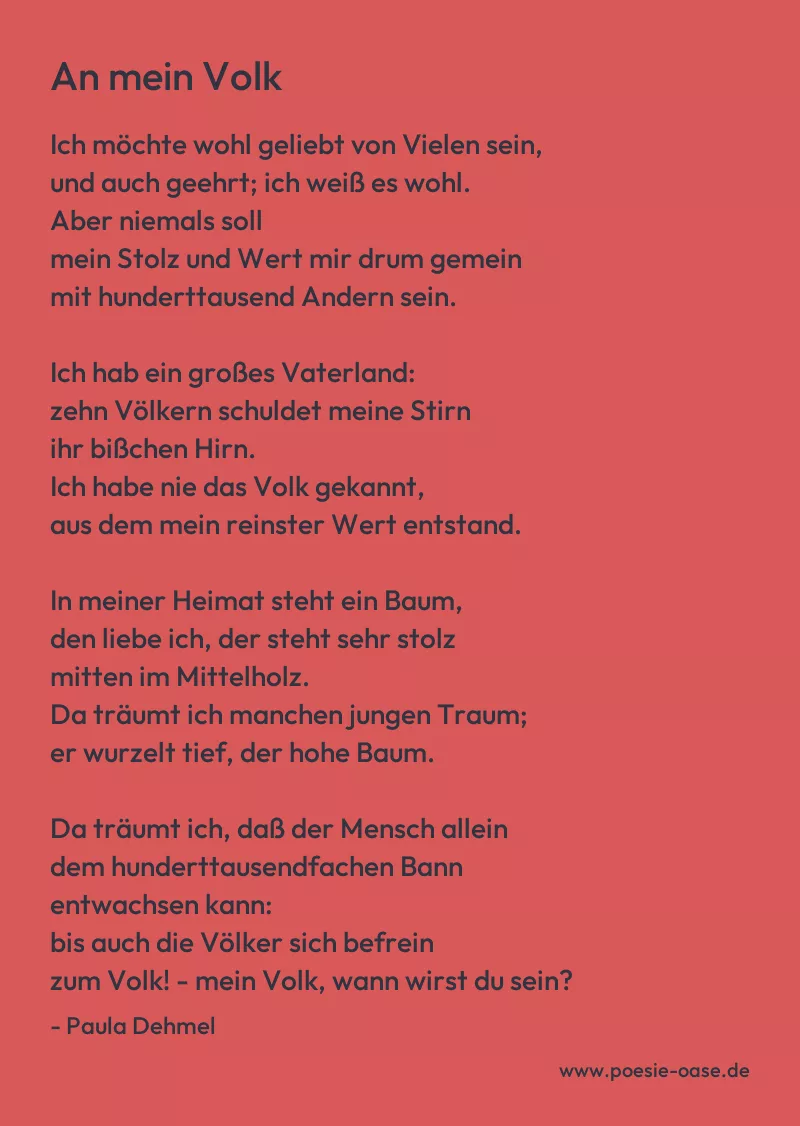
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An mein Volk“ von Paula Dehmel ist eine tiefgründige Reflexion über die Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung, die aber durch ein starkes Gefühl der Individualität und eine Vision von grenzenloser Verbundenheit geprägt ist. Das Gedicht beginnt mit dem Wunsch nach Liebe und Ehre, doch sogleich grenzt sich die Autorin von der Masse ab, indem sie sich weigert, ihren „Stolz und Wert“ mit „hunderttausend Andern“ zu teilen. Dieser Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Zugehörigkeit und dem Festhalten an der eigenen Individualität ist ein zentrales Thema.
Der zweite Teil des Gedichts erweitert den Horizont von Dehmels Identität. Sie fühlt sich nicht nur ihrem eigenen Volk, sondern „zehn Völkern“ verpflichtet, da ihre „Stirn“ diesen ihren „bißchen Hirn“ verdankt. Dieser Anspruch auf Universalität und die Distanz zum „Volk“, aus dem ihr „reinster Wert entstand“, deuten auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Nationalen hin. Sie scheint sich als Kosmopolitin zu verstehen, deren Identität über nationale Grenzen hinausreicht.
Die dritte Strophe führt eine persönliche, fast idyllische Ebene ein. Der „Baum“ in ihrer Heimat, der „sehr stolz“ steht, wird zum Symbol für ihre Wurzeln und ihre Träume. Die Beschreibung des Baumes als zentrales Element im „Mittelholz“ vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und Beständigkeit, aber auch von Einsamkeit inmitten der Natur. Hier verknüpft sie ihre persönlichen Erfahrungen mit einer universellen Sehnsucht nach Freiheit und Selbstverwirklichung.
Der letzte Teil des Gedichts kulminiert in einer Vision der Befreiung. Die Autorin träumt davon, dass der Mensch „allein“ dem „hunderttausendfachen Bann“ entwachsen kann, und sehnt sich nach einer Welt, in der sich „auch die Völker… befrein zum Volk“. Diese Vision von Freiheit und Einheit wird jedoch von einer Frage begleitet: „mein Volk, wann wirst du sein?“. Diese Frage offenbart sowohl ihre Hoffnung als auch ihre Ungeduld, die Vision einer geeinten Menschheit zu verwirklichen. Das Gedicht endet also mit einem Appell, der die Spannung zwischen individuellem Stolz und universeller Verbundenheit auflöst und gleichzeitig die Vision einer zukünftigen, vereinten Menschheit antreibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.