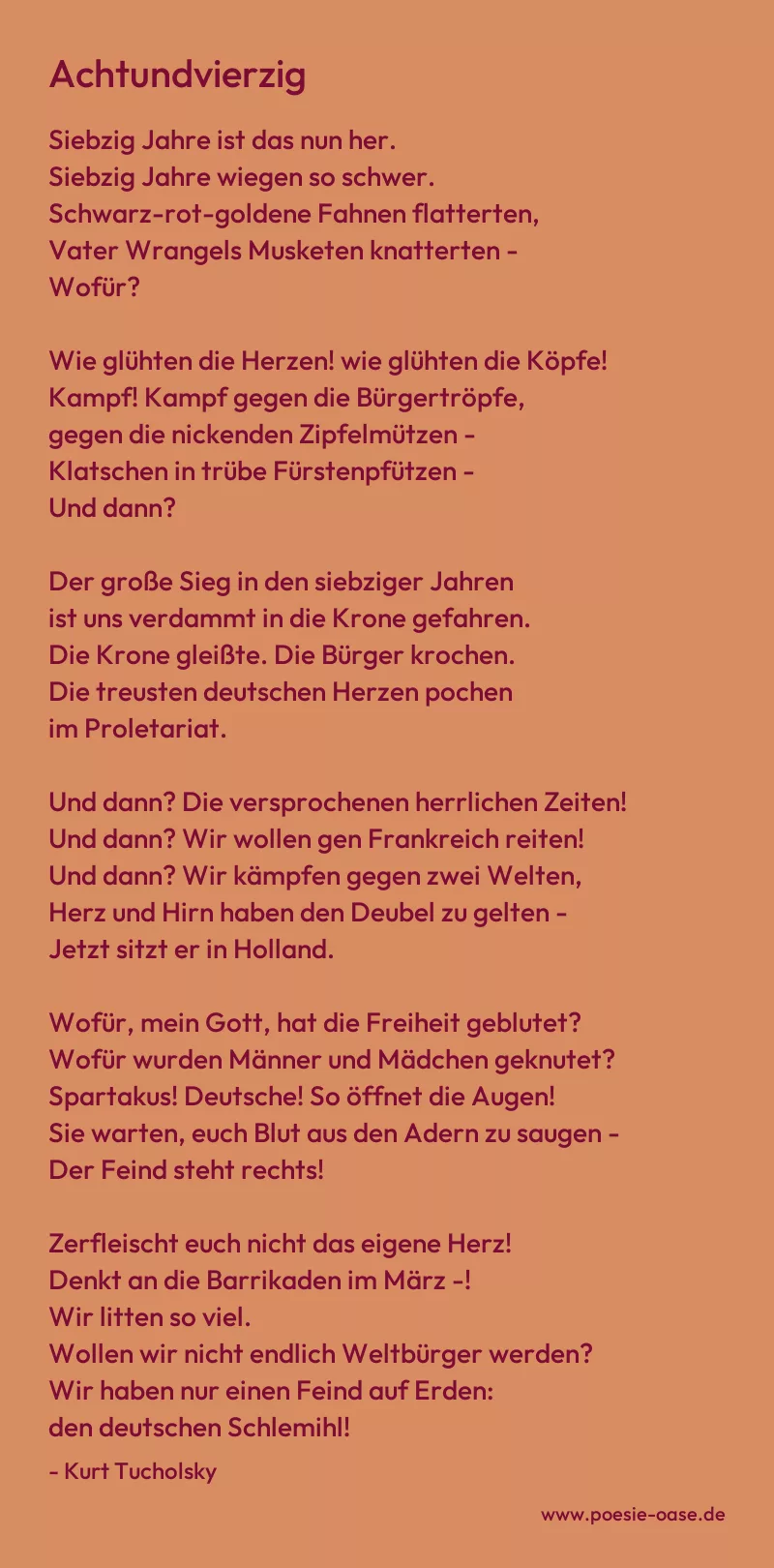Achtundvierzig
Siebzig Jahre ist das nun her.
Siebzig Jahre wiegen so schwer.
Schwarz-rot-goldene Fahnen flatterten,
Vater Wrangels Musketen knatterten –
Wofür?
Wie glühten die Herzen! wie glühten die Köpfe!
Kampf! Kampf gegen die Bürgertröpfe,
gegen die nickenden Zipfelmützen –
Klatschen in trübe Fürstenpfützen –
Und dann?
Der große Sieg in den siebziger Jahren
ist uns verdammt in die Krone gefahren.
Die Krone gleißte. Die Bürger krochen.
Die treusten deutschen Herzen pochen
im Proletariat.
Und dann? Die versprochenen herrlichen Zeiten!
Und dann? Wir wollen gen Frankreich reiten!
Und dann? Wir kämpfen gegen zwei Welten,
Herz und Hirn haben den Deubel zu gelten –
Jetzt sitzt er in Holland.
Wofür, mein Gott, hat die Freiheit geblutet?
Wofür wurden Männer und Mädchen geknutet?
Spartakus! Deutsche! So öffnet die Augen!
Sie warten, euch Blut aus den Adern zu saugen –
Der Feind steht rechts!
Zerfleischt euch nicht das eigene Herz!
Denkt an die Barrikaden im März -!
Wir litten so viel.
Wollen wir nicht endlich Weltbürger werden?
Wir haben nur einen Feind auf Erden:
den deutschen Schlemihl!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
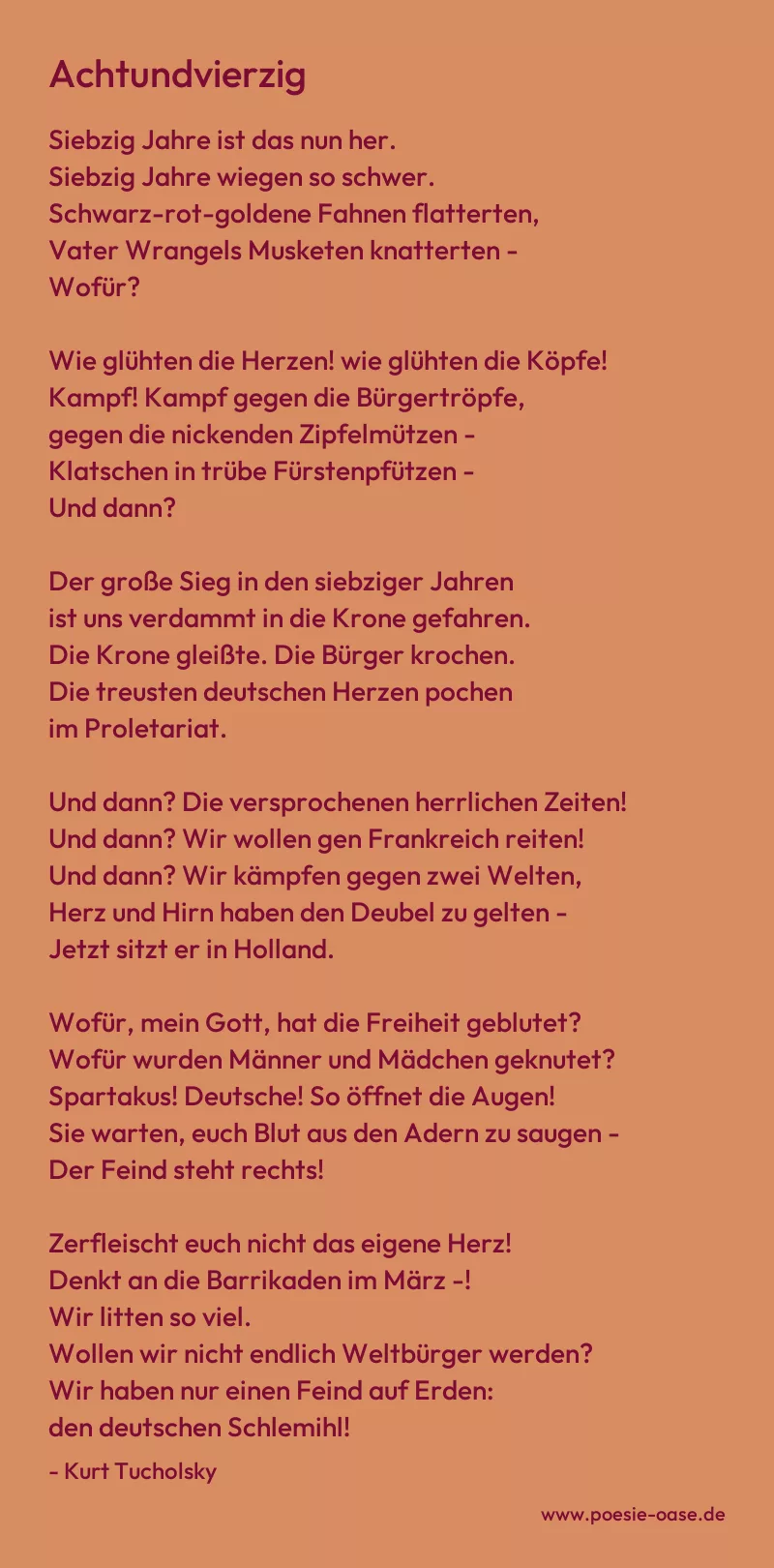
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Achtundvierzig“ von Kurt Tucholsky ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Idealen und Enttäuschungen der deutschen Revolution von 1848. Es ist eine Anklage an die deutsche Geschichte, die sich durch eine bittere Ironie und eine tiefe Desillusionierung auszeichnet. Tucholsky beginnt mit der Feststellung, dass siebzig Jahre seit dem Ereignis vergangen sind, eine Zeit, die wiegt und die Geschichte mit all ihren Konsequenzen erfahrbar macht. Die erste Strophe beschreibt die Aufbruchsstimmung und die Ideale, die mit der Revolution verbunden waren: die schwarz-rot-goldenen Fahnen, das Streben nach Freiheit und die Ablehnung der alten Ordnung. Doch die rhetorische Frage „Wofür?“ deutet bereits die spätere Ernüchterung an.
Die zweite Strophe führt die Ursachen der Enttäuschung weiter aus. Der Kampf gegen die „Bürgertröpfe“ und „Fürstenpfützen“ wird beschrieben, wobei Tucholsky die Verlogenheit und Selbstgefälligkeit der alten Eliten anprangert. Die Zeile „Der große Sieg in den siebziger Jahren / ist uns verdammt in die Krone gefahren.“ zeigt, wie die scheinbare Einheit und der Nationalstolz nach dem Deutsch-Französischen Krieg die wahren sozialen Probleme überdeckten und die Revolutionäre in ihren Bemühungen scheiterten. Die anschließenden Fragen „Und dann?“ unterstreichen die Leere und das Scheitern der erhofften Veränderungen, die nur zu weiteren Konflikten und Ungerechtigkeiten führten.
Die dritte und vierte Strophe werden noch pessimistischer. Die Erwartungen an eine bessere Zukunft, an „herrliche Zeiten“ und den Kampf gegen zwei Welten, werden durch die Erkenntnis der Gewalt und des Krieges konterkariert. Tucholsky stellt fest, dass die Freiheit mit Blut bezahlt wurde, und prangert die Ungerechtigkeit an, die weiterhin herrschte. Die Zeile „Der Feind steht rechts!“ ist ein deutlicher Appell an die Arbeiterbewegung, sich gegen die reaktionären Kräfte und die Feinde der Freiheit zu wenden. Der Autor ruft dazu auf, die Augen zu öffnen und die wahren Feinde zu erkennen, die nur darauf aus sind, die Menschen auszubeuten.
Die letzte Strophe gipfelt in einem Appell zur Einheit und zur Überwindung des nationalen Egoismus. Tucholsky fordert, sich nicht im eigenen Elend zu zerfleischen und an die Barrikaden im März zu erinnern. Die Menschen hatten genug gelitten. Er wünscht sich, dass sie endlich „Weltbürger“ werden und sich von den nationalen Grenzen befreien. Der „deutsche Schlemihl“ ist der eigentliche Feind, ein Symbol für die Selbstgefälligkeit, Engstirnigkeit und den Opportunismus, die die deutsche Geschichte geprägt haben. Das Gedicht endet mit einer eindringlichen Warnung und einem Aufruf zur Solidarität, um eine gerechtere und freiere Welt zu schaffen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.