Friedrich! du, dem ein Gott das für die Sterblichen
Zu gefährliche Loos eines Monarchen gab,
Und, o Wunder! der du glorreich dein Loos erfüllst,
Siehe! deiner von Ruhm trunkenen Tage sind
Zwanzigtausend entflohn; ihnen folgt allzubald
Jedes Denkmaal von dir: alle die Tempel, der
Götter! wäre doch ich dieser beneidete
Barde! selber zu schwach, aber durch meinen Held,
Und die Sprache gestärkt, die wie Kalliopens
Tuba tönet: wie weit liess ich euch hinter mir,
Sänger Heinrichs! und dich, ganze Zunft Ludewigs.
An den König
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
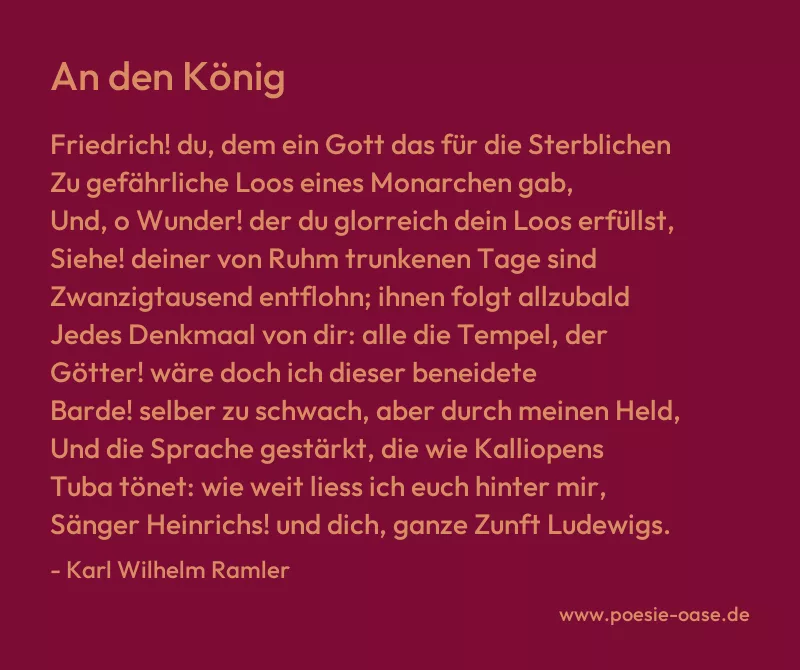
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den König“ von Karl Wilhelm Ramler ist eine Huldigung an Friedrich, vermutlich Friedrich II. von Preußen, und eine Reflexion über dessen Ruhm und die Vergänglichkeit des Lebens. Ramler, ein Dichter der Aufklärung, nutzt die Gelegenheit, den König zu preisen und gleichzeitig über die Rolle des Dichters und die Natur des Ruhms zu sinnieren. Das Gedicht ist geprägt von einer pathetischen Sprache, die typisch für die Epoche ist, und von einer bewussten Anlehnung an antike Vorbilder, was sich in der Verwendung von Begriffen wie „Götter“ und der Anrufung des Königs wie eines Gottes manifestiert.
Im Zentrum steht die Bewunderung des Dichters für Friedrichs Regierungszeit und die damit verbundene Leistung. Die Zeile „Friedrich! du, dem ein Gott das für die Sterblichen / Zu gefährliche Loos eines Monarchen gab“ deutet auf die göttliche Legitimation der Monarchie und die Schwere der königlichen Verantwortung hin. Ramler betont die außergewöhnliche Fähigkeit des Königs, diese schwere Bürde zu tragen und sein Amt glorreich auszufüllen. Die Erwähnung von „Zwanzigtausend“ Tagen, die vergangen sind, und die Ankündigung der kommenden „Denkmale“ – also der Werke und Errungenschaften des Königs – weisen auf die Notwendigkeit hin, die Leistungen des Herrschers zu würdigen und zu verewigen.
Der zweite Teil des Gedichts widmet sich der Rolle des Dichters und der Kunst. Ramler wünscht sich, ein besserer Barde zu sein, um den Ruhm des Königs angemessen zu besingen. Er gesteht seine eigene Unzulänglichkeit ein, doch seine Hoffnung liegt in der Kraft der Sprache und der Möglichkeit, durch seinen „Held“ und eine gestärkte Sprache, die „wie Kalliopens / Tuba tönet“, den König zu preisen. Hier spricht Ramler seine Bewunderung für die Antike und die großen Dichter der Vergangenheit aus, indem er sich von ihnen absetzt und gleichzeitig ihre Vorbilder ehrt. Die letzten Zeilen, in denen er die „Sänger Heinrichs“ und „ganze Zunft Ludewigs“ erwähnt, deuten auf eine Abgrenzung von anderen Dichtern hin, wobei er sich selbst eine größere Ausdruckskraft und einen höheren Anspruch zuschreibt.
Insgesamt ist das Gedicht ein Ausdruck der königlichen Verehrung, verbunden mit einer Selbstreflexion des Dichters über seine eigene Rolle und die Grenzen seiner Kunst. Es spiegelt die Ideale der Aufklärung wider, indem es die Bedeutung von Tugend, Ruhm und der Verewigung großer Taten hervorhebt. Ramler verbindet hier die Huldigung an einen Herrscher mit einem Anspruch an die Dichtkunst selbst, was das Gedicht zu einem typischen Beispiel für die literarische Kultur des 18. Jahrhunderts macht.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
