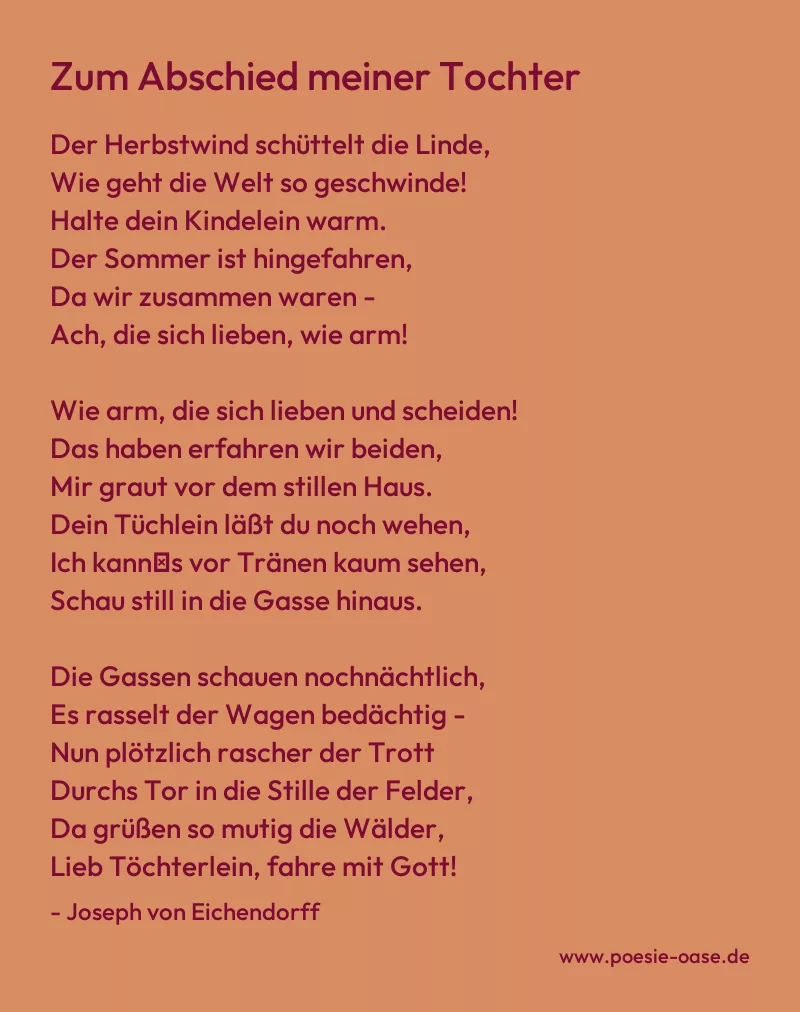Zum Abschied meiner Tochter
Der Herbstwind schüttelt die Linde,
Wie geht die Welt so geschwinde!
Halte dein Kindelein warm.
Der Sommer ist hingefahren,
Da wir zusammen waren –
Ach, die sich lieben, wie arm!
Wie arm, die sich lieben und scheiden!
Das haben erfahren wir beiden,
Mir graut vor dem stillen Haus.
Dein Tüchlein läßt du noch wehen,
Ich kann′s vor Tränen kaum sehen,
Schau still in die Gasse hinaus.
Die Gassen schauen nochnächtlich,
Es rasselt der Wagen bedächtig –
Nun plötzlich rascher der Trott
Durchs Tor in die Stille der Felder,
Da grüßen so mutig die Wälder,
Lieb Töchterlein, fahre mit Gott!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
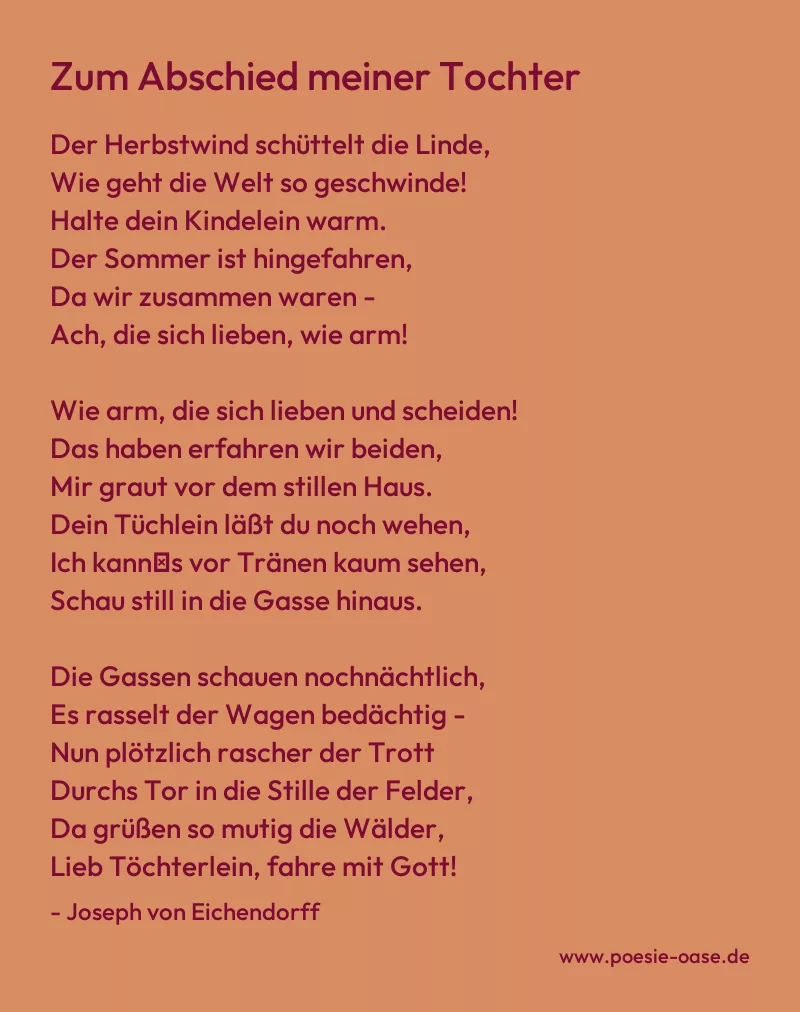
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zum Abschied meiner Tochter“ von Joseph von Eichendorff ist eine melancholische Reflexion über Abschied und Vergänglichkeit, eingebettet in die herbstliche Natur. Der Dichter nutzt die Jahreszeit, um die Trennung von seiner Tochter zu thematisieren, wobei die herbstlichen Bilder von fallenden Blättern und Abschied des Sommers die Traurigkeit und den Verlust verstärken, die mit dem Abschied einhergehen. Die sprachliche Gestaltung ist von schlichten, klaren Worten geprägt, die die tiefe emotionale Verbundenheit zwischen Vater und Tochter unterstreichen.
Die erste Strophe etabliert das zentrale Thema des Gedichts: die Vergänglichkeit und die rasche Bewegung der Welt. Der Herbstwind, der die Linde schüttelt, symbolisiert den Wandel und die Unaufhaltsamkeit der Zeit. Die Worte „Halte dein Kindelein warm“ drücken väterliche Fürsorge und Schutz aus, während der Hinweis auf den vergangenen Sommer die Schönheit der gemeinsamen Zeit hervorhebt, die nun dem Abschied weicht. Die Zeile „Ach, die sich lieben, wie arm!“ resümiert das Gefühl des Verlustes und die Tragik des Abschieds, die diejenigen erleben, die sich innig lieben.
In der zweiten Strophe vertieft sich die Melancholie. Die Zeile „Wie arm, die sich lieben und scheiden!“ verstärkt die bereits etablierte Trauer über die Trennung. Der Dichter betont seine eigene Betroffenheit mit „Mir graut vor dem stillen Haus“, was die Leere und Stille widerspiegelt, die durch den Abschied entsteht. Die poetische Geste des winkenden Taschentuchs der Tochter, das der Vater kaum sehen kann, da ihm die Tränen die Sicht vernebeln, unterstreicht die Intensität der Gefühle und die Unfähigkeit, den Abschied zu akzeptieren. Die Aufforderung, in die Gasse zu schauen, deutet auf die bevorstehende Reise und die damit verbundene Ungewissheit hin.
Die letzte Strophe verlagert den Fokus auf die bevorstehende Abreise. Das „nochnächtliche“ Aussehen der Gassen und das bedächtige Rasseln des Wagens suggerieren eine frühe Abreise und die langsame, bedrückende Gewissheit des Abschieds. Die Steigerung der Geschwindigkeit des Wagens „Nun plötzlich rascher der Trott“ verstärkt die Unaufhaltsamkeit des Geschehens. Das Gedicht findet seinen Höhepunkt in dem ergreifenden Wunsch „Lieb Töchterlein, fahre mit Gott!“, der sowohl ein Segenswunsch als auch ein Ausdruck des Vertrauens in eine höhere Macht ist, die über das Wohl der Tochter wacht. Diese Zeile verwebt Abschiedsschmerz und die Hoffnung auf Schutz und Geborgenheit auf eine ergreifende Weise.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.