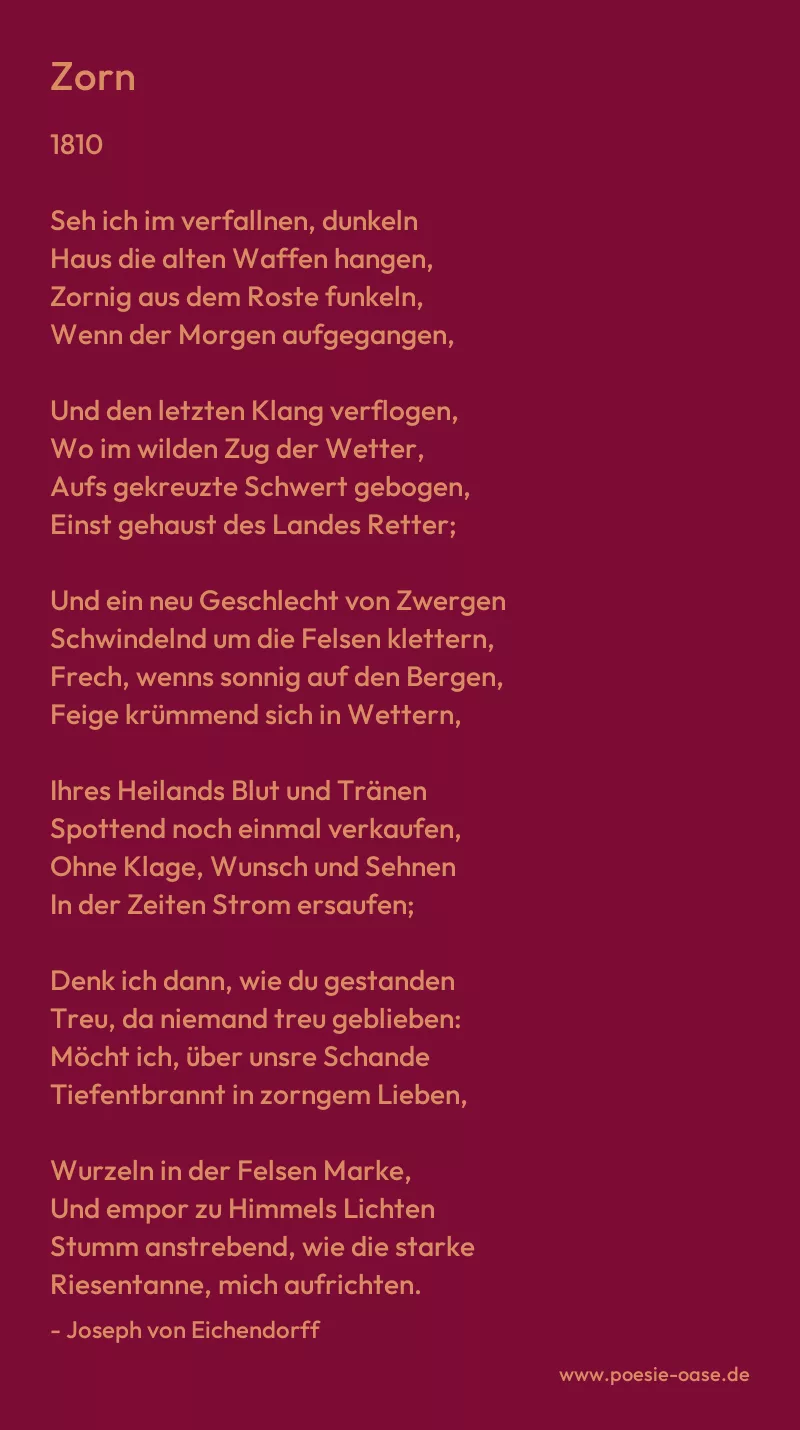Zorn
1810
Seh ich im verfallnen, dunkeln
Haus die alten Waffen hangen,
Zornig aus dem Roste funkeln,
Wenn der Morgen aufgegangen,
Und den letzten Klang verflogen,
Wo im wilden Zug der Wetter,
Aufs gekreuzte Schwert gebogen,
Einst gehaust des Landes Retter;
Und ein neu Geschlecht von Zwergen
Schwindelnd um die Felsen klettern,
Frech, wenns sonnig auf den Bergen,
Feige krümmend sich in Wettern,
Ihres Heilands Blut und Tränen
Spottend noch einmal verkaufen,
Ohne Klage, Wunsch und Sehnen
In der Zeiten Strom ersaufen;
Denk ich dann, wie du gestanden
Treu, da niemand treu geblieben:
Möcht ich, über unsre Schande
Tiefentbrannt in zorngem Lieben,
Wurzeln in der Felsen Marke,
Und empor zu Himmels Lichten
Stumm anstrebend, wie die starke
Riesentanne, mich aufrichten.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
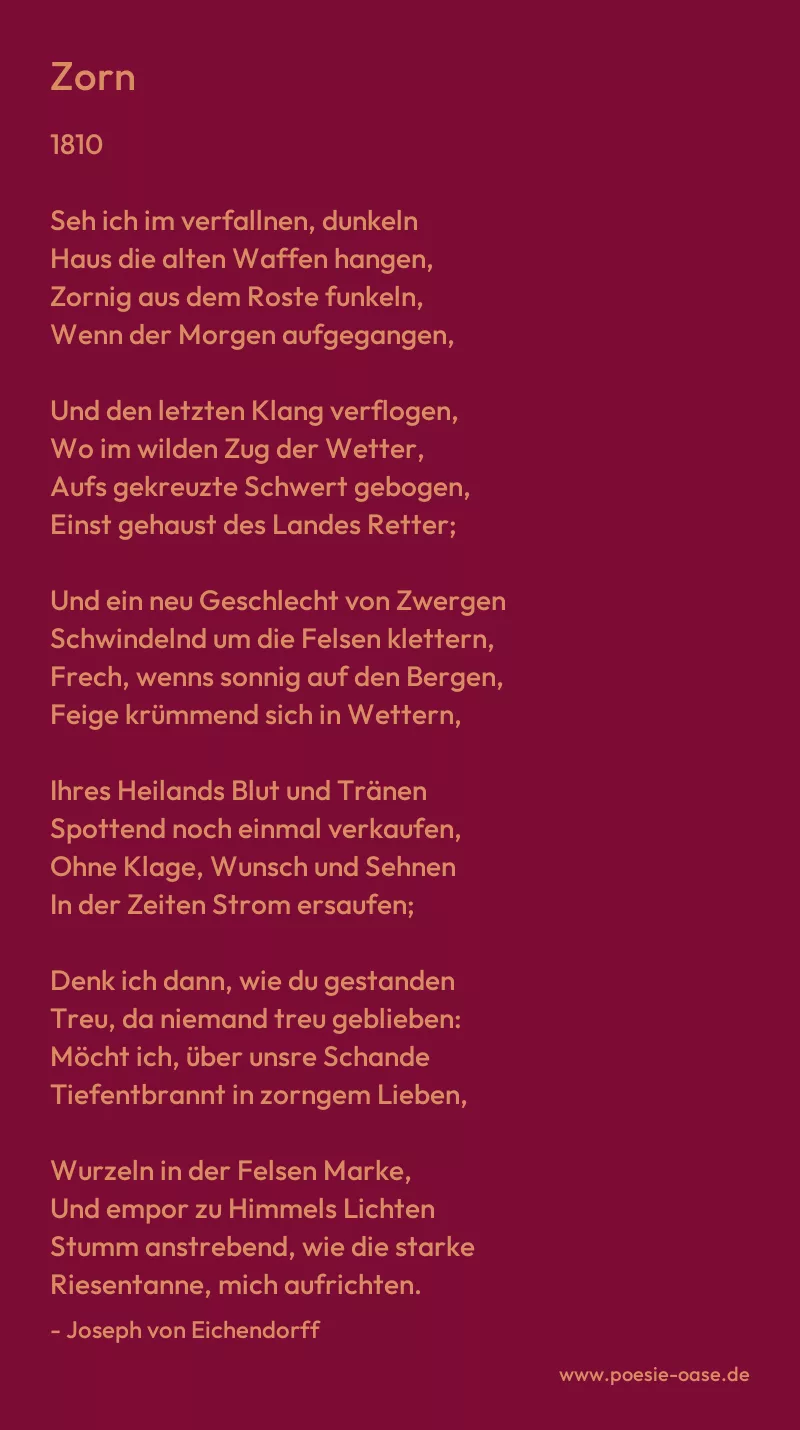
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zorn“ von Joseph von Eichendorff, geschrieben im Jahr 1810, ist eine tiefgründige Reflexion über Verlust, Verfall und die Sehnsucht nach Tugend und Beständigkeit in einer chaotischen Welt. Es beginnt mit einer Beobachtung der Vergangenheit, symbolisiert durch alte Waffen in einem verfallenen Haus, und dem Aufkeimen von Zorn angesichts der Unbeständigkeit und des Verrats der Gegenwart. Das Gedicht vereint romantische Motive wie Naturverbundenheit und die Sehnsucht nach einem idealen, moralischen Zustand.
Die ersten beiden Strophen malen ein Bild des Verfalls. Der „zornig funkelnde“ Rost der Waffen deutet auf eine verlorene, ruhmreiche Vergangenheit hin. Die Zeile über den „Retter des Landes“ und das gekreuzte Schwert erinnert an eine Zeit des Heldentums und der Tapferkeit, die jedoch vorbei ist. Der Kontrast zur Gegenwart wird in der dritten Strophe deutlich, wo eine „neu[e] Geschlecht von Zwergen“ beschrieben wird, die feige und verachtenswert erscheinen. Diese Zwerge, die sich in den Stürmen ducken und die Errungenschaften der Vergangenheit verspotten, stehen für den moralischen Niedergang und die fehlende Ehrlichkeit der aktuellen Gesellschaft.
Die vierte Strophe verstärkt den Eindruck des Verrats und der moralischen Verdorbenheit, indem sie das Bild von „Heilands Blut und Tränen“ aufgreift, das von der neuen Generation „spottend“ verkauft wird. Dies deutet auf eine tiefgreifende Desillusionierung und den Verlust von Werten hin, der mit der Fähigkeit einhergeht, sich mit dem Lauf der Zeit abzufinden. Das Fehlen von Klage, Wunsch und Sehnen unterstreicht die emotionale Leere und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das in dieser zerrütteten Welt herrscht.
In den letzten beiden Strophen findet das Gedicht jedoch einen Weg zur Erlösung. Die Erinnerung an eine vergangene Treue weckt den Wunsch nach einem Neuanfang, nach einer Wiederherstellung der Werte. Der Sprecher möchte angesichts der Schande durch „zorngem Lieben“ Wurzeln schlagen und sich, wie eine „starke Riesentanne“, in Richtung Himmel aufrichten. Diese Metapher des Baumes symbolisiert Stärke, Beständigkeit und das Streben nach dem Göttlichen, sowie die Hoffnung auf einen Neuanfang. Das Gedicht endet mit einem positiven und ermutigenden Ausblick, indem es die Möglichkeit der Überwindung des Zorns durch Liebe und des Wachstums aus der Asche des Verfalls hervorhebt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.