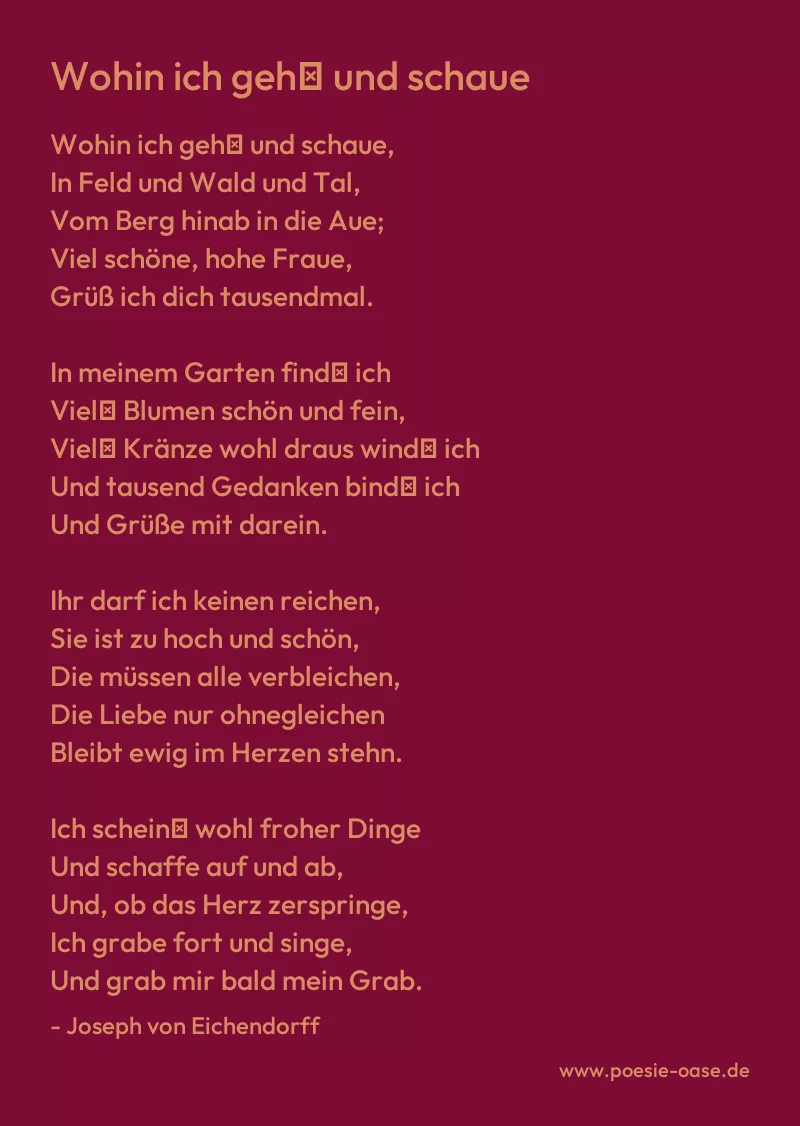Wohin ich geh′ und schaue
Wohin ich geh′ und schaue,
In Feld und Wald und Tal,
Vom Berg hinab in die Aue;
Viel schöne, hohe Fraue,
Grüß ich dich tausendmal.
In meinem Garten find′ ich
Viel′ Blumen schön und fein,
Viel′ Kränze wohl draus wind′ ich
Und tausend Gedanken bind′ ich
Und Grüße mit darein.
Ihr darf ich keinen reichen,
Sie ist zu hoch und schön,
Die müssen alle verbleichen,
Die Liebe nur ohnegleichen
Bleibt ewig im Herzen stehn.
Ich schein′ wohl froher Dinge
Und schaffe auf und ab,
Und, ob das Herz zerspringe,
Ich grabe fort und singe,
Und grab mir bald mein Grab.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
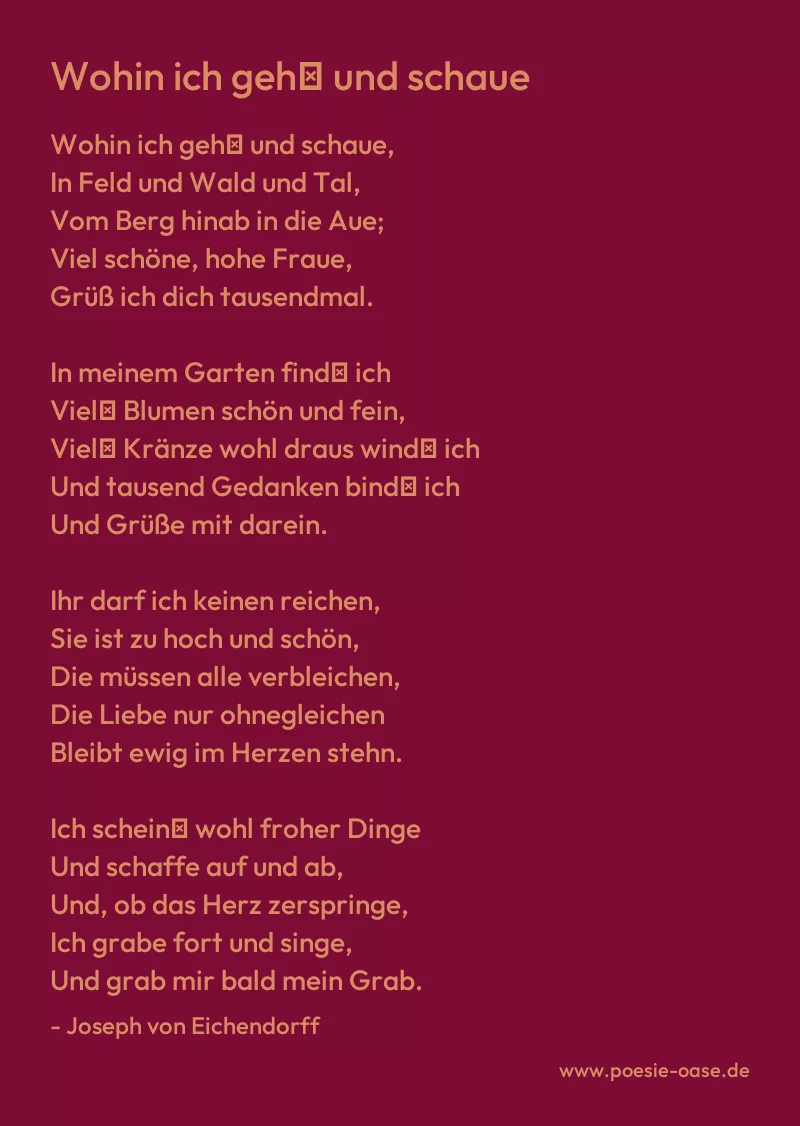
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wohin ich geh‘ und schaue“ von Joseph von Eichendorff ist eine melancholische Liebeserklärung, die von unerfüllter Sehnsucht und dem Wissen um die Unerreichbarkeit der Geliebten geprägt ist. Der Titel deutet bereits auf die weite Suche des lyrischen Ichs nach dem Objekt seiner Liebe hin, eine Suche, die sich durch die gesamte Natur erstreckt. Die Natur wird hier nicht nur als Kulisse, sondern auch als Spiegel der eigenen Gefühle dargestellt, wobei die Schönheit der Umgebung die Tiefe des Schmerzes noch verstärkt.
In den ersten beiden Strophen wird die Verehrung der Geliebten in einem Natur- und Blumenbild zum Ausdruck gebracht. Das lyrische Ich grüßt die „schöne, hohe Fraue“ tausendmal, und die Blumen, die es im Garten findet, dienen dazu, Kränze zu winden und Gedanken sowie Grüße mit einzubinden. Diese Aktivitäten verdeutlichen die Hingabe und die Bemühungen des lyrischen Ichs, die Liebe durch symbolische Gesten zu manifestieren. Der Garten, ein Ort der persönlichen Intimität, wird zur Bühne für die eigene Verehrung, doch die eigentliche Geliebte ist unerreichbar.
Die dritte Strophe offenbart die Tragik der Situation: Die Geliebte ist „zu hoch und schön“, um ihr die geschaffenen Kränze und Grüße zu reichen. Die Blumen, die Symbole der Liebe und Verehrung, müssen verblassen, während nur „die Liebe nur ohnegleichen“ ewig im Herzen verbleibt. Hier wird die Diskrepanz zwischen der äußeren Form der Verehrung und der inneren Erfahrung des Liebeskummers deutlich. Die Erkenntnis der Unerreichbarkeit führt zu einem Gefühl der Vergeblichkeit und des Verlusts.
Die letzte Strophe erreicht ihren Höhepunkt in einer fast resignierten Selbstverzweiflung. Das lyrische Ich gibt vor, fröhlich zu sein und arbeitet fleißig, doch im Inneren droht das Herz zu „zerspringen“. Das Singen wird zu einem Ausdruck der Verzweiflung, und das Graben im Garten wird zu einer Metapher für das Graben des eigenen Grabes. Der scheinbare Optimismus ist eine Fassade, die die tiefgreifende Traurigkeit und das Gefühl des nahenden Endes verbergen soll. Eichendorffs Gedicht ist somit ein berührender Ausdruck der unerwiderten Liebe und der Melancholie, die aus dem Wissen um die Unerreichbarkeit eines geliebten Menschen entsteht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.