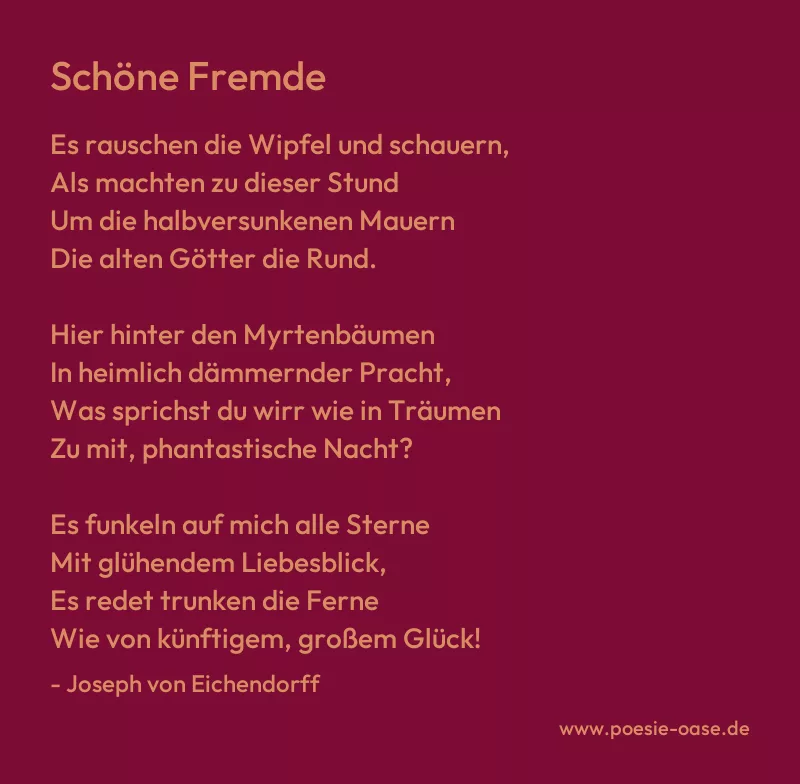Schöne Fremde
Es rauschen die Wipfel und schauern,
Als machten zu dieser Stund
Um die halbversunkenen Mauern
Die alten Götter die Rund.
Hier hinter den Myrtenbäumen
In heimlich dämmernder Pracht,
Was sprichst du wirr wie in Träumen
Zu mit, phantastische Nacht?
Es funkeln auf mich alle Sterne
Mit glühendem Liebesblick,
Es redet trunken die Ferne
Wie von künftigem, großem Glück!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
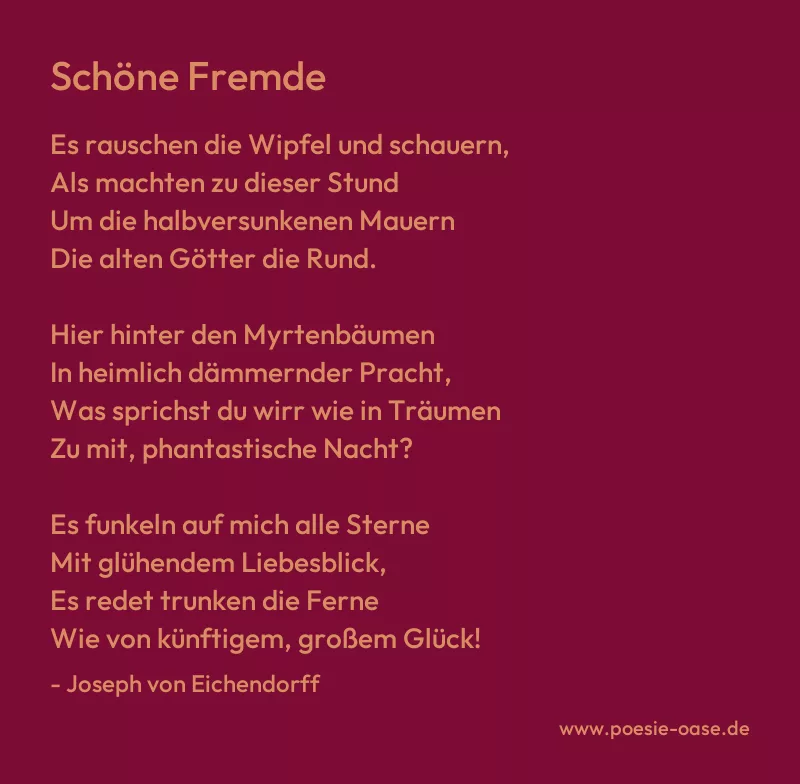
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schöne Fremde“ von Joseph von Eichendorff entführt den Leser in eine romantische, beinahe mystische Szenerie. Es beschreibt eine von Natur und historischem Geist geprägte Landschaft, in der die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwimmen. Die „halbversunkenen Mauern“ und die „alten Götter“, die „Rund“ machen, wecken Assoziationen an eine vergangene, vielleicht idealisierte Epoche und erzeugen eine Atmosphäre der Ehrfurcht und des Geheimnisses. Die Natur, personifiziert durch rauschende und schauernde Wipfel, scheint in Kommunikation mit den Göttern zu treten, wodurch eine tiefere Bedeutungsebene suggeriert wird.
Der zweite Teil des Gedichts verlagert den Fokus von der äußeren Landschaft zur inneren Erfahrung des lyrischen Ichs. Die „Myrtenbäume“ und die „heimlich dämmernde Pracht“ schaffen einen intimen Raum, in dem die Nacht als phantastische Gesprächspartnerin fungiert. Die Frage an die Nacht deutet auf eine Suche nach Erkenntnis und eine Sehnsucht nach dem Unbekannten hin. Die Wirrheit der Worte, wie im Traum gesprochen, unterstreicht die Auflösung der klaren Gedankenstrukturen und die Hingabe an das Unbewusste. Die Nacht wird zum Medium, durch das das Ich in Kontakt mit einer anderen, vielleicht spirituellen Dimension tritt.
Im letzten Abschnitt wird die romantische Stimmung durch die Anrufung der Sterne und die Beschreibung der „trunkenen Ferne“ verstärkt. Die Sterne mit ihrem „glühenden Liebesblick“ symbolisieren Liebe und Verheißung, während die Ferne, die „von künftigem, großem Glück“ spricht, eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft ausdrückt. Hier wird die Sehnsucht nach dem Unbekannten und die Hoffnung auf Erfüllung greifbar. Der Zustand der Trunkenheit deutet auf eine Auflösung der Grenzen zwischen Selbst und Welt hin, auf das Eintauchen in einen Zustand höchster Ekstase und Glückseligkeit.
Insgesamt spiegelt das Gedicht die zentrale romantische Thematik der Sehnsucht und des Fernwehs wider. Es vermittelt eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und eine Hinwendung zur inneren Welt. Eichendorff nutzt bildhafte Sprache und rhetorische Fragen, um eine Atmosphäre der Mystik und des Geheimnisses zu erzeugen. Das Gedicht feiert die Schönheit des Unbekannten und die Hoffnung auf Glück, die sich in der romantischen Seele widerspiegelt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.