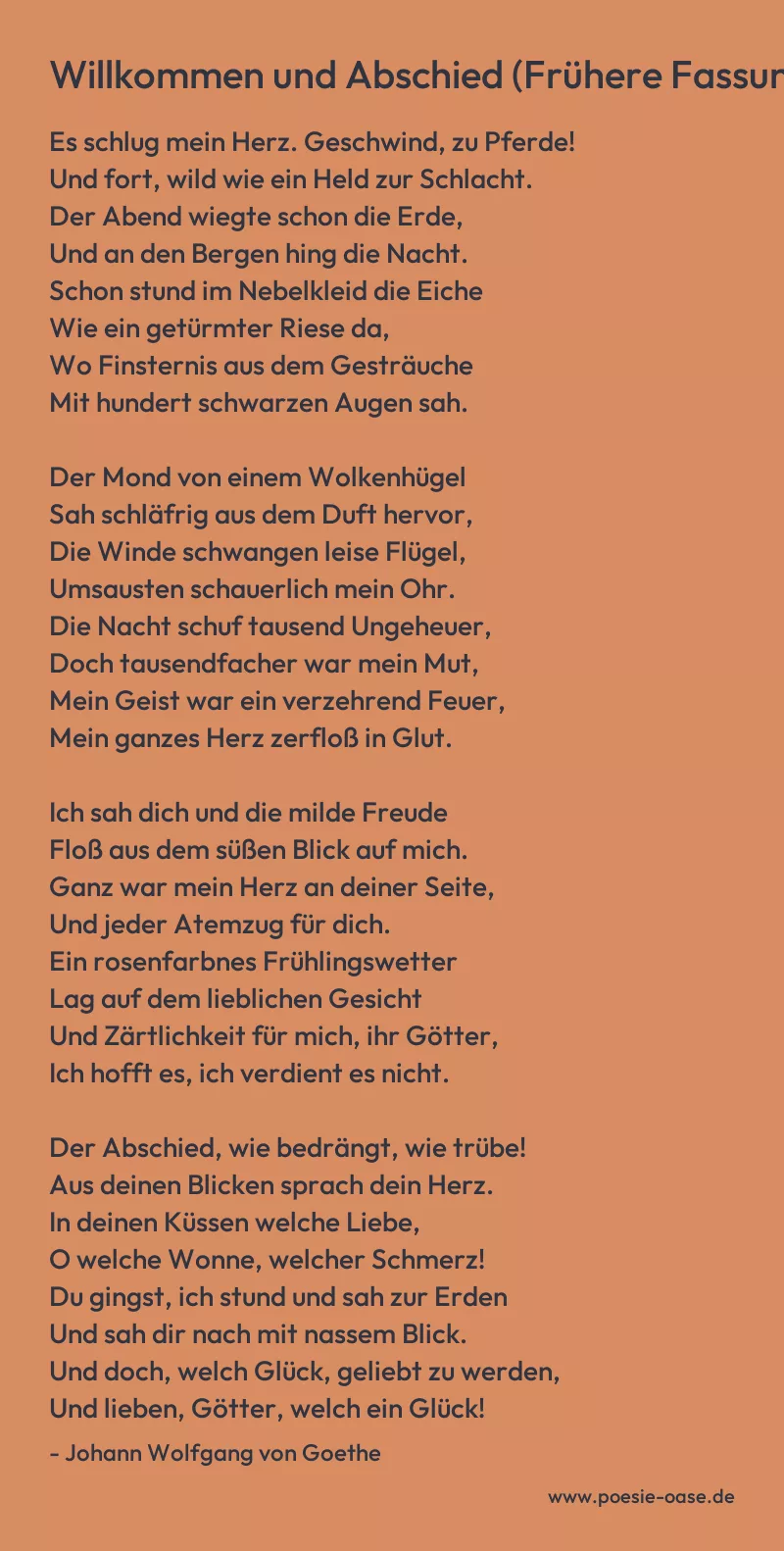Emotionen & Gefühle, Feiertage, Freude, Gedanken, Helden & Prinzessinnen, Heldenmut, Himmel & Wolken, Kriegsgeschichte, Legenden, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Natur, Sagen, Tiere, Vergänglichkeit, Wälder & Bäume, Weisheiten, Wut
Willkommen und Abschied (Frühere Fassung, 1771)
Es schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde!
Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht.
Schon stund im Nebelkleid die Eiche
Wie ein getürmter Riese da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.
Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah schläfrig aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr.
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch tausendfacher war mein Mut,
Mein Geist war ein verzehrend Feuer,
Mein ganzes Herz zerfloß in Glut.
Ich sah dich und die milde Freude
Floß aus dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz an deiner Seite,
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Lag auf dem lieblichen Gesicht
Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter,
Ich hofft es, ich verdient es nicht.
Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz.
In deinen Küssen welche Liebe,
O welche Wonne, welcher Schmerz!
Du gingst, ich stund und sah zur Erden
Und sah dir nach mit nassem Blick.
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden,
Und lieben, Götter, welch ein Glück!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
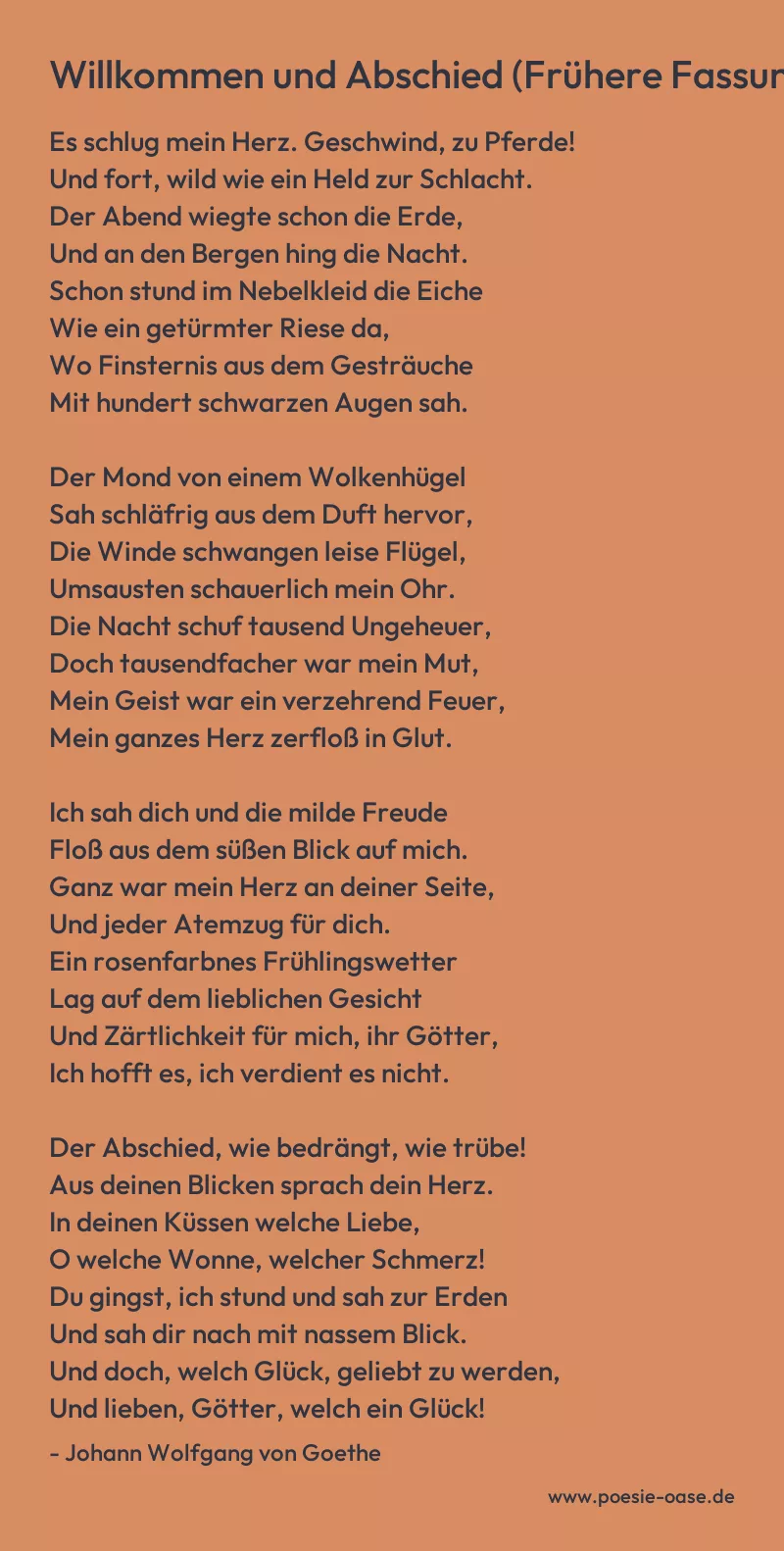
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Willkommen und Abschied (Frühere Fassung, 1771)“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine frühe romantische Darstellung des stürmischen Aufbruchs, der Ekstase und des Schmerzes, die mit der Liebe verbunden sind. Es schildert eine Reise, sowohl im physischen als auch im emotionalen Sinne, von der Aufbruchsstimmung über die Vereinigung mit der Geliebten bis hin zum schmerzlichen Abschied, und mündet in einer Reflexion über das Glück des Liebens und Geliebtwerdens.
Die ersten beiden Strophen beschreiben die Aufbruchsstimmung und die Reise des lyrischen Ichs. Der Befehl „Geschwind, zu Pferde!“ und die Beschreibung der „wilden“ Fahrt erzeugen ein Gefühl der Ungestümtheit und des Drangs. Die Natur, insbesondere die hereinbrechende Nacht mit der „Finsternis aus dem Gesträuche“, wird als Kulisse für die innere Aufruhr des Ichs dargestellt. Die Bilder der „Ungeheuer“ und das „verzehrende Feuer“ im Geist symbolisieren die Intensität der Emotionen, die das lyrische Ich durchlebt, und deuten auf die innere Zerrissenheit hin.
Die dritte Strophe ist der Höhepunkt der Vereinigung mit der Geliebten gewidmet. Das Bild der Natur ändert sich von düster zu lieblich, mit dem „rosenfarbnen Frühlingswetter“ und dem „lieblichen Gesicht“. Die Freude der Liebenden wird durch den Ausdruck „Floß aus dem süßen Blick auf mich“ und das Gefühl der Erfüllung, „Ganz war mein Herz an deiner Seite“, vermittelt. Der Hinweis auf die „Zärtlichkeit“ und die Aussage „Ich hofft es, ich verdient es nicht“ zeigt die tiefe Dankbarkeit und die Ungläubigkeit des Ichs gegenüber dem empfundenen Glück.
Die vierte und letzte Strophe thematisiert den Abschied und die damit verbundene Trauer. Die „trüben“ Blicke und die „Wonne, welcher Schmerz“ in den Küssen unterstreichen die Ambivalenz der Liebe, die Freude und Leid untrennbar miteinander verbindet. Der Abschied wird als schmerzhaft erlebt, aber die abschließenden Zeilen geben der Erfahrung eine tiefere Bedeutung. Die Reflexion über das Glück des Liebens und Geliebtwerdens, trotz aller Schmerzen, zeugt von der romantischen Idealisierung der Liebe als einer existenziellen Erfahrung.
Goethes frühes Gedicht zeichnet sich durch seine dynamische Sprache, die kraftvollen Bilder und die emotionale Tiefe aus. Es fängt die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle ein, von der stürmischen Leidenschaft über die zarte Freude bis hin zum schmerzlichen Abschied. Die klare Struktur und die reinen Reime verstärken die Wirkung der Emotionen und machen das Gedicht zu einem eindrucksvollen Zeugnis romantischer Sehnsucht und Liebeserfahrung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.